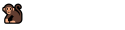Die Finanz- und Kriegsthesen von Marc Friedrich
Auf dem Youtube-Kanal „{ungeskriptet} by Ben“ war vor Kurzem wieder der Betriebswirt1 und Crash-Prophet2 Marc Friedrich zu sehen.3 In diesem Video trifft er viele Aussagen, denen man sehr leicht zustimmen dürfte, sofern man weder ein SPD- oder noch ein Grünen-Stammwähler ist. Einige Aussagen (bspw. 1:09:22–1:13:00) erfordern eine allerdings eine Auseinandersetzung mit ihnen. Friedrichs Gesprächspartner hat es gerade leider hier unterlassen, kritisch nachzufragen.
Um diesen Abschnitt fair zu betrachten, sind hier zunächst die sechs Kernaussagen4 des betrachteten Abschnitts:
- Die Kriegsrhetorik nimmt massiv zu.
- Diese Kriegsrhetorik ist ein Symptom eines kaputten Systems. Der wahre Treiber hinter allem ist Geld und Macht.
- Das aktuelle Schuldenproblem ist unlösbar durch Wachstum.
- Inflation wird gezielt eingesetzt, um Schulden zu entwerten. Die Inflation enteignet die Menschen systematisch. Das 2 %-Inflationsziel der Notenbanken ist keine Stabilität.
- Sachwerte steigen, weil Fiat-Währungen an Wert verlieren.
- Die Lösung ist Investition in limitierte Sachwerte.
Problematisch sind die Aussagen 2 und 4. Der Vollständigkeit halber wird kurz auf alle Aussagen eingegangen.
Aussage 1: Die Kriegsrhetorik nimmt massiv zu.
„Und wir sehen ja gerade, dass die Kriegsgefahr massiv zunimmt. Wir haben auf einmal eine Kriegsrethorik, die hätten wir vor zwei, drei Jahren uns nicht getraut auch nur irgendwie auch anzusprechen. Auf einmal haben wir hier 5 % vom BIP, die wir in die Kriegswirtschaft stecken sollen. Wir sehen auf einmal wieder die Diskussion über eine Wehrpflicht auch für Frauen teilweise. Wir hören auf einmal Politiker, die richtig kriegsgeil sind. Wir müssen den Russen in Russland niederringen. Noch mal, ich bin in der Friedenszeit groß geworden. Das war die geilste Zeit überhaupt. Diese Friedensdividende nach dem Zweiten Weltkrieg. Krieg war verpöhnt. Ja, wir hatten eine Verteidigungsarmee und auf einmal geht alles ganz in die andere Richtung. Also bitte Leute, wacht auf.“
Marc Friedrich stellt das 5 %-Ziel der NATO hier falsch dar. Ausgaben für die Terrorismusbekämpfung und militärisch nutzbare Infrastruktur können in die 5 % mitgerechnet werden.5 Die meisten Staaten werden sicherlich ihre Infrastrukturausgaben als militärische Ausgaben mitrechnen, insbesondere Deutschland. Schließlich ist die deutsche Infrastruktur in einem recht schlechtem Zustand. Mit der Subsumierung von Infrastrukturausgaben unter Militärausgaben hat der deutsche Staat dank Befreiung von der Schuldenbremse einen großen Handlungsspielraum, der dann sogar NATO-Partner glücklich macht. Auch sind der Bevölkerung, dem Wähler, Investitionen in Brücken leichter zu verkaufen, als neue Panzer. Daher wird die Regierung unter Merz sicherlich keine 5 % des BIP (45 % vom Bundeshaushalt) in die Bundeswehr stecken. Diese erste Aussage von Marc Friedrich ist somit schon sehr irreführend.
In diesem Abschnitt wirkt es zudem, als gäbe es keine Ursache für die neuen Ziele der NATO und Deutschlands, als seien westliche Politiker einfach scharf auf Krieg.6 Die NATO hat Russland nicht angegriffen. Womöglich hat sie in den 1990er-Jahren Abmachungen mit Russland zur Ausdehnung nach Osten gebrochen. Die Ursache für die nun doch recht weit gehende Kriegsrhetorik ist allerdings der Angriff Russlands auf die Ukraine, für den es schwer sein dürfte, eine gute Rechtfertigung zu finden.
Trotz Friedrichs polemisch aufgeladener Sprache, die eine nüchterne Debatte erschwert, kann man über jede Kritik an der Kriegsrhetorik dankbar sein, da Krieg nicht normalisiert werden und nicht das Ziel sein sollte.
Aussage 2: Diese Kriegsrhetorik ist ein Symptom eines kaputten Systems. Der wahre Treiber hinter allem ist Geld und Macht.
„Warum haben wir diese Kriegsrethorik? Weil unser System am Arsch ist. Und das, ich sag immer wieder, es geht immer ums Geld. Du musst dich immer fragen, worum geht’s überhaupt? Und es ist immer Geld und Macht. Es geht alles ums Geld. Follow the money. Geld regiert die Welt. Und wenn ein Geldsystem am Ende ist, wenn die Schuldenberge zu groß werden, gibt’s halt ein paar Möglichkeiten, um diese Schuldenberge irgendwie aufzulösen.“
Dieser Abschnitt ist argumentativ substanzlos, suggeriert aber, dass wirtschaftliche Gründe entweder den Ukraine-Krieg oder die aktuelle Kriegsrhetorik ausgelöst haben. Nebulös stellt Marc Friedrich Zusammenhänge her, spricht von Geld, Macht und Krieg. Es mag plausibel klingen, dass es Interessen gibt und irgendwer profitiert, aber diese Sätze sind letztendlich nur Geschwafel. Wo ist der Zusammenhang, wo sind Subjekte, Motive und Anhaltspunkte für diese Suggestionen bzw. Behauptungen?
Aussage 3: Das aktuelle Schuldenproblem ist unlösbar durch Wachstum.
„Follow the money. Geld regiert die Welt. Und wenn ein Geldsystem am Ende ist, wenn die Schuldenberge zu groß werden, gibt’s halt ein paar Möglichkeiten, um diese Schuldenberge irgendwie aufzulösen. Der erste ist, wir wachsen aus der Krise raus. Also die das Wirtschaftswachstum ist stärker als das Schuldenwachstum. Haben wir nicht mehr. Wir haben ja drittes Jahr Rezession in Deutschland. Europa ist am Ende, Schuldenberge explodieren. Also Wachstum in der Welt, die sich eher in die Richtung Deglobalisierung bewegt und Protektionismus mit Zöllen und so weiter, sehe ich nicht. Und die meisten Märkte haben wir schon erobert, ne? Damals 89 haben wir dann irgendwie den Eisernen Vorhang beerdigt und auf einmal hatten wir einen riesen Markt mit Milliarden neuen Menschen in Osteuropa, aber auch in Asien. Sehe ich nicht mehr.“
Es fehlt auch hier insgesamt an argumentativer Klarheit. Leider sind die Hinweise auf Deglobalisierung und Protektionismus dennoch berechtigt. Wir sehen Handelskonflikte und Reshoring. Auch ist der historische Bezug auf 1989 nicht schlecht. Neue ungesättigte Märkte fehlen nun grundsätzlich. Dieser düsteren wirtschaftlichen Gesamtsicht muss man wohl zunächst zustimmen. Aber die Situation ist nicht statisch. Präsidenten kommen und gehen; neue Handelsabkommen schaffen neue Potenziale; neue Technologien schaffen neues Wachstum ...
Aussage 4: Inflation wird gezielt eingesetzt, um Schulden zu entwerten. Die Inflation enteignet die Menschen systematisch. Das 2 %-Inflationsziel der Notenbanken ist keine Stabilität.
„Zweite Möglichkeit, um das Schuldenproblem zu lösen, Inflation. Ja, das versucht man momentan. Problem ist, Inflation verlieren wir alle. Ja, wir verlieren Kaufkraft. Ich möchte es ganz drastisch darstellen, nicht nur Kaufkraft, verlieren sogar Lebenszeit. [...] Ja, muss mal überlegen. Seit 2001 und so geht’s überall weiter und wir alle, du, ich, die Zuschauer, wir investieren das wertvollste und rarste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit. Und wenn diese limitierte Lebenszeit und diese gespeicherte Lebenszeit in Form von Geld uns dann genommen wird durch Abgaben und Steuern, aber vor allem durch Inflation, dann musst du aktiv werden und das passiert momentan. Deswegen versuchen die Politiker Inflation zu erzeugen.“
In diesem Abschnitt suggeriert Marc Friedrich alarmistisch, emotional und polemisch, dass Inflation eine bewusst gewählte Strategie der Politik ist, um Schulden abzubauen. Man muss zustimmen, dass eine hohe Inflation schlecht ist und unter Umständen als eine Art der Besteuerung gesehen werden kann. Und von Inflation profitieren wirklich hauptsächlich Schuldner, damit natürlich auch verschuldete Staaten.
Staaten könnten also ein Interesse an Inflation haben – aus der Perspektive des Schuldenabbaus. Staaten handeln aber nicht. Menschen handeln. In diesem Fall Politiker. Warum sollten nun Politiker Inflation erzeugen wollen? Haben sie nicht in den letzten Jahren versucht, die Inflation zu bekämpfen? Politiker, die für vier Jahre in die Exekutive oder Legislative gewählt wurden, haben gar kein Interesse daran, die Inflation zu erhöhen – selbst wenn dadurch die Staatsschulden nennenswert sinken würden. Die Staatsschulden sind ein Generationenproblem, das den Wähler nicht direkt interessiert. Die Inflation ist allerdings ein Alltagsproblem, das dem Politiker die Wiederwahl kosten kann. Wer wählt den Politiker, der die x Billionen oder Trillionen Dollar Staatsschulden in 4 Jahren um 1 bis 2 % senken oder jedenfalls nicht erhöhen möchte, wenn ein anderer Politiker verspricht, dass die Preise für Eier und Benzin fallen?
Und wie könnten Politiker die Inflation erhöhen, wenn sie denn ein Interesse daran hätten? Im Euroraum haben deutsche Politiker wenige Möglichkeiten, die Inflation kurzfristig zu erhöhen. Sie könnten einen anderen deutschen Vertreter in den EZB-Rat schicken, der sich für eine Senkung der Leitzinsen einsetzt und in größerem Umfang Staatsanleihen durch die EZB kaufen möchte. Außerdem könnte der deutsche Staat die Staatsausgaben massiv erhöhen – und die Staatsschulden weiter vergrößern.
Marc Friedrich weiß aber sicherlich, dass Inflation etwas komplexer ist, als dass die Politik sie leicht beeinflussen könnte. Angebot, Nachfrage, Geldpolitik, Löhne, geopolitische Entwicklungen und vieles mehr beeinflussen die Inflation. Die letzte große Inflation wurde hauptsächlich das verknappte Angebot verursacht (Corona, Ukraine, Lieferketten).
„Weil das System einfach immer weitere Schulden braucht und weil wir alle enteignet werden, damit der Staat sich entschulden kann. Und das werden sie versuchen. [...] Warum? Weil die wieder Geld drucken müssen. Alle Notenbanken senken ja schon wieder die Zinsen, weil die Schuldenberge zu groß sind. Man kann ja nicht die mit diesen gigantischen Schuldenbergen hohe Zinsen haben.“
Auch hier muss man sich doch zunächst fragen, wer überhaupt welche Interessen hat: Akteure sind eben Individuen und diese agieren in den seltensten Fällen gegen ihre eigenen Interessen und oftmals eher mit einer hohen Gegenwartspräferenz. Die Motive und Interessen sollte man bei solchen Behauptungen nicht nur nebulös andeuten, sondern konkret machen oder eben komplett sein lassen. Die Aussage ist außerdem stark vereinfachend und vermischt verschiedene ökonomische Konzepte wie Staatsverschuldung, Geldpolitik und Inflation ohne differenzierte Einordnung. Sie ist zudem in sich widersprüchlich: Einerseits wird behauptet, der Staat müsse sich entschulden, gleichzeitig heiße es, das System brauche immer neue Schulden – beides schließt sich aus. Auch die Verbindung zwischen Zinssenkung und „Geld drucken“ ist inkonsistent dargestellt. Insgesamt bedient die Aussage alarmistische Narrative, fördert Verunsicherung und trägt nicht zu einer sachlichen Debatte bei.
„Mir konnte noch kein Notenbanker erklären, warum das erklärte Ziel der Notenbank ist 2 % Inflation pro Jahr, damit wir Stabilität erreichen. Das ist doch nicht Stabilität. Stabilität wäre null. 2 % jedes Jahr weniger klingt für mich scheiße. Als Schwabe sowieso. Ja, also wenn ich jedes Jahr 2 % weniger habe, das hat doch nichts mit Stabilität zu tun. Und warum?“
Diese Kritik am Inflationsziel der Zentralbanken von einem Betriebswirt irritiert. Sicher erscheint es Laien auf den ersten Blick besser, wenn die Preise in Geschäft beim Einkauf nicht um 2 % steigen. Aber es geht nicht um die Preise, sondern um das Preisniveau. Das Preisniveau soll tatsächlich offiziell jedes Jahr um 2 % steigen.7 So werden, laut Ökonomen, Preisstabilität und Investitionssicherheit gewährleistet. Das Preisniveau beinhaltet nicht nur die Preise, die man als Konsument bezahlt, sondern auch die Löhne, die man als Arbeitnehmer erhält.
Gegen eine 0 %-Inflation sprechen beispielsweise folgende beiden Gründe. Erstens steigt das Deflationsrisiko, das schwerwiegendere wirtschaftliche Folgen haben kann (z. B. Konsumzurückhaltung, Investitionsstopp, Schuldenlast steigt real an).
Zweitens ist zu beachten, dass Löhne nominell kaum sinken können. Bei Neuverhandlungen werden Arbeitnehmer sich so gut wie nie auf eine nominale Lohnsenkung einlassen. Ohne Inflation käme die wirtschaftliche Dynamik dadurch nahezu zum Stillstand. Das hätte zur Folge, dass sämtliche Berufsgruppen dauerhaft steigende Löhne erhalten müssten und dadurch alle Güter und Dienstleistungen kontinuierlich teurer würden. Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei unterschiedlichen Gütern und Dienstleistungen muss jedoch fortlaufend neu austariert werden. Faktisch bedeutet das: Alle Preise – einschließlich der Löhne – werden ständig neu ausgehandelt, auch wenn dies oft unbemerkt bleibt. Man erhält fortwährend Angebote, bestimmte Tätigkeiten für Betrag X zu verrichten oder bestimmte Leistungen für Betrag Y zu beziehen. Da Löhne nominal kaum sinken können, ist Inflation ein notwendiges Instrument, um Preis- und Lohnanpassungen zu ermöglichen und das wirtschaftliche Gleichgewicht zu erhalten.
Aussage 5: Sachwerte steigen, weil Fiat-Währungen an Wert verlieren.
„Ich kann es nur noch mal adressieren. Wir sehen ja gerade Allzeithoch bei Aktien, bei Gold, bei Bitcoin. Das heißt aber im Umkehrschluss Allzeittief in Euro, Dollar und Franken, weil 1 Kilo Gold ist 1 Kilo Gold, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, aber wenn der im Preis steigt, steigt nicht der Preis für Bitcoin, sondern die Kaufkraft für Euro sinkt immer weiter. Ich habe es immer wieder aufgezeigt, auch im Buch.
Dass ein Bitcoin immer ein Bitcoin ist, klingt wie ein argumentativer Tautologismus („X = X“) und sagt nichts über die ökonomische Bedeutung aus. Der Preis eines Gutes ist immer das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Ein Bitcoin mag technisch konstant sein, aber sein ökonomischer Wert ist keineswegs fix. Dasselbe gilt für Gold: Auch wenn die physische Menge gleich bleibt, bestimmt der Markt den Preis – und dieser kann schwanken, ohne dass sich die „Kaufkraft“ einer Währung zwingend verschlechtert.
„Wir haben seit Einführung des Euros offiziell 43 % Kaufkraft verloren, aber gegenüber Bitcoin 99,99 % Kaufkraft verloren. Also Gold 95 % sogar. Goldpreis hat sich verzehnfacht bald.“
Im Detail kann man beispielsweise nicht sagen, was Ursache und was Wirkung ist. Der Anstieg des Gold- oder Bitcoinpreises kann auch auf eine höhere Nachfrage, Marktpsychologie, Angebotsknappheit oder Spekulation zurückzuführen sein – nicht nur auf eine sinkende Kaufkraft von Fiat-Währungen. Zudem ignoriert er, dass Kaufkraft ein relatives Konzept ist: Ein steigender Preis eines Assets bedeutet nicht automatisch, dass eine Währung insgesamt an Kaufkraft verliert. Dazu müsste sich die Inflation durchgehend und in vielen Gütern zeigen – nicht nur in Vermögenspreisen.
Der Vergleich der Kaufkraft gegenüber einem volatilen, spekulativen Asset wie Bitcoin ist irreführend. Der „Verlust von 99,99 %“ ist nur dann relevant, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin der richtige Maßstab für Wertstabilität sei – was höchst umstritten ist. Bitcoin ist extrem volatil und unterliegt stark spekulativen Einflüssen.
Diese Argumentation von Friedrich ist also suggestiv, vereinfachend und teilweise irreführend. Sie beruht auf einer stark wertenden Interpretation ökonomischer Zusammenhänge, die einer differenzierten Betrachtung nicht standhält. Kaufkraftverlust kann ein reales Problem sein – aber seine Bewertung sollte auf fundierter Analyse basieren, nicht auf selektiven Vergleichen mit spekulativen Assets.
Aussage 6: Die Lösung ist Investition in limitierte Sachwerte.
„Die Inflation wird zurückkommen. Ihr braucht jetzt auf jeden Fall limitierte Werte in dieser inflationären Welt. Man braucht Gold, Silber, Wald, egal was. Ich habe alles im Buch aufgezeigt, was man braucht. Und siehe da, Gold Allzeithoch, Aktien Allzeithoch, Bitcoin Alltzeithoch.“
Die Aussage ist etwas vereinfachend und nutzt rückblickende Kursentwicklungen zur scheinbaren Bestätigung eigener Thesen (Confirmation Bias). Die pauschale Warnung vor Inflation ohne Kontext oder Belege wirkt auch hier alarmistisch. Ob das hier eine ausgewogene Anlagestrategie oder eine Werbung für ein Buch ist, soll hier nicht bewertet werden.
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Friedrich
2 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/buecher-ueber-finanzkrisen-die-masche-der-crash-propheten-16488989.html
4 Der Begriff Aussage wird hier nicht im atomaren Sinne gebraucht.
6 Natürlich erwähnte Friedrich den russischen Angriffskrieg und verurteilte ihn.