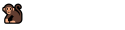"Q" statt "LGBTQIA+" – Wie viele Buchstaben braucht die Vielfalt?
Die Abkürzung LGBTQIA+ ist ein sehr präsenter Teil der öffentlichen Debatte und scheint immer länger zu werden. Sie steht für Vielfalt, für Sichtbarkeit und für die Anerkennung unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten. Doch je länger die Buchstabenreihe wird, desto öfter taucht die Frage auf: Wie viele Buchstaben braucht die Vielfalt?
Die Geschichte dieser Abkürzung begann in den 1970er- und 80er-Jahren mit LGB (lesbisch, schwul, bisexuell). In den 1990ern kam das T für trans Personen hinzu. Später wurden das I (intergeschlechtlich) und das A (asexuell/aromantisch/agender) ergänzt. Das Q steht allgemein für den Sammelbegriff "queer" und tauchte ebenfalls in den 1990ern auf, gewann aber erst im 21. Jahrhundert größere Bedeutung. Mit der Zeit etablierte sich zusätzlich das „+“, um allen weiteren Identitäten Raum zu geben. Damit sind sowohl "Q" als auch das Plus Sammelbegriffe. Sowohl das Plus als auch das "Q" beinhalten nicht nur "LGBTIA", sondern auch einander. Wie viele Sammelbegriffe braucht es in einer Abkürzung?
Reicht also ein "Q"? Das „Q“ bzw. "queer" ist eben ein Oberbegriff, der jede Identität jenseits von Heterosexualität und Cis-Geschlechtlichkeit einschließt. Ob lesbisch, schwul, bi, trans, inter oder asexuell – all diese Erfahrungen können unter „queer“ zusammengefasst werden. Wer sich nicht eindeutig zuordnen möchte oder sich zwischen mehreren Kategorien bewegt, findet im „Q“ ebenfalls Platz. Dadurch könnte die Abkürzung nicht nur kürzer, sondern auch inklusiver und verständlicher für Außenstehende werden.
Die Idee hinter dieser langen Abkürzung ist natürlich, dass jeder Buchstabe eine bestimmte Gruppe von Menschen sichtbarer macht. Das „L“ rückt Lesben in den Fokus, das „T“ stellt sicher, dass trans Personen mehr Aufmerksamkeit erfahren, und das „A“ gibt asexuellen Menschen mehr Sichtbarkeit. Ohne diese Buchstaben bestünde eventuell die Gefahr, dass unter dem allgemeinen Begriff „queer“ quantitativ dominante Gruppen (z. B. schwule Männer ("G")) in den Vordergrund rücken, während kleinere Gruppen von Menschen weniger Beachtung fänden – was allerdings aufgrund der Quantität nicht schwierig zu rechtfertigen wäre.
Gleichzeitig wird das Akronym durch die ständigen Erweiterungen immer komplexer. Da verliert man schnell den Überblick: In welchen Publikationen und in welchen Diskussionen wird denn die Gesamtheit dieser Buchstaben korrekt aufgeführt? Und dann noch in der richtigen Reihenfolge? Die ständigen Erweiterungen schaffen ungewollt Distanz und erschweren Akzeptanz in der breiten Gesellschaft. Wer die vielen berechtigten Forderungen hinter diesen Buchstaben ernst nimmt, sollte der Masse der Bevölkerung keine Gedächtnisakrobatik abverlangen.