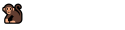Der Herr der Ringe und Entropie
Der Herr der Ringe ist keine bloße Abenteuergeschichte, in der unscheinbare Wesen zufällig in einen epischen Kampf gegen das Böse geraten und wider aller Wahrscheinlichkeit siegen. Es ist eine Saga des unerbittlichen Verfalls, der sich weder um Moral noch um Willenskraft oder Leid schert. Tolkiens Werk ist durchdrungen von Nostalgie und Entropie. Ein Gefühl, das auch bei seinem amerikanischen Apologeten mit den kopierten "R" spürbar ist.
Der Begriff Entropie stammt aus der Thermodynamik und bezeichnet das Maß der Unordnung in einem System. Jedes geschlossene System führt nicht zu immer größerer Ordnung, sondern zu zunehmender Entropie – so der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Energie verteilt sich, Strukturen lösen sich auf und Differenzen werden eingeebnet. Ordnung ist stets nur eine fragile Insel im Strom des Chaos.
J. R. R. Tolkien hat diesen physikalischen Grundgedanken auf mythische Weise in Literatur übersetzt. Der Herr der Ringe erzählt nicht nur den Kampf Gut gegen Böse, sondern auch den beständigen Prozess des Abbaus, der Vereinfachung, des „Schrumpfens“ der Welt.
Die abnehmende Komplexität der Lebensformen
In Mittelerde herrscht ein klarer entropischer Vektor: vom Größeren zum Kleineren, vom Mächtigeren zum Schwächeren, vom Komplexen zum Einfachen.
Am Anfang von Herr der Ringe wird schnell klar, dass die unsterblichen, schönen und weisen Elben Mittelerde verlassen:
“Wood-elves! They’re going to the harbour beyond the White Towers — the Grey Havens. They are leaving Middle-earth, never to return.”
Auch merkt der Leser, dass die alten Königreiche wie Númenor untergegangen oder nur noch Schatten ihrer selbst sind. Geschenke von Göttern, große Baukunst und die Blütezeit der Lebewesen überhaupt – all das liegt lange zurück. Die Maiar wie Gandalf und Saruman haben in der Romantrilogie noch ein letztes Mal einen großen Einsatz, aber treten dann aber in den Hintergrund. Am Ende bleiben die Menschen zurück – sterblich, begrenzter, schlichter.
“The Power of the Three Rings has ended. The Time Has Come … For The Dominion of Men.“
Die Welt verliert noch vor den Geschehnissen und dann noch einmal am Ende von Der Herr der Ringe an Komplexität, so wie in der Thermodynamik Strukturen zerfallen und Energieformen nivelliert werden.
“The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it.“
Tolkien formuliert das nicht in naturwissenschaftlicher Sprache, aber das zugrundeliegende Muster ist identisch: Entropie als Reduktion von kultureller und materieller Größe und Bedeutung – und als Verlust von Magie. Einzig die Erinnerung an die glorreichen Zeiten bleibt, aber auch sie verblasst.
“Yet it is not despair. For even in the fading, the memory of glory persists, though it too shall fade, as the light of stars diminishes in the west.”
Nicht nur Wesen, sondern auch Fähigkeiten unterliegen diesem Zerfall. Das Schmieden der Ringe, die Baukunst von Númenor, die elbischen Lieder – all das gehört zu einer Vergangenheit, die nicht reproduzierbar ist. Mittelerde ist durchzogen von Ruinen und Relikten.
Philosophisch gesehen könnte man sagen: Kultur selbst ist ein entropisches System. Erinnerung erodiert, Fähigkeiten versickern und Wissen löst sich auf. In der Gegenwart wirkt die Vergangenheit immer wie eine goldene, unerreichbare Höhe.
Hier spiegelt Tolkien ein existenzielles Erlebnis: Der Leser erlebt die Geschichte als eine Verlustgeschichte, als einen Abstieg.
Die Parallele zu Game of Thrones
George R. R. Martin greift dasselbe Motiv auf. Auch in A Song of Ice and Fire ist die Gegenwart nur ein Schatten der Vergangenheit: die Valyrische Hochkultur mit ihrer Schmiedekunst und Bauweise ist verschwunden, zurück bleiben nur noch Fragmente, deren Technik niemand mehr versteht.
“Perhaps magic was once a mighty force in the world, but no longer. What little remains is no more than the wisp of smoke that lingers in the air after a great fire has burned out, and even that is fading. Valyria was the last ember, and Valyria is gone. The dragons are no more, the giants are dead, the children of the forest forgotten with all their lore.“
Beide Autoren formen damit eine Gegenbewegung zu modernen Fortschrittserzählungen. Ihre Welten sind keine Evolution, sondern eine Degeneration – nicht immer linear, aber unumkehrbar.
Existenz im entropischen Universum
Hier öffnet sich der philosophische Blick: Wenn die Welt – ob physikalisch oder kulturell – unvermeidlich dem Zerfall zusteuert, was bleibt dann?
Die Thermodynamik sagt: Struktur ist vergänglich. Doch gerade in diesem Wissen liegt der Sinn des Handelns begründet. Ordnung entsteht, nicht um ewig zu dauern, sondern um dem Chaos für einen Moment eine Form abzuringen.
So sind die Gefährten keine Sieger über die Entropie, sondern Aufhalter, Verzögerer. Saurons Niederlage verhindert nicht den Untergang aller Größe, sie verschafft nur Aufschub. Und doch ist dieser Aufschub nicht sinnlos: Er schafft Raum für Schönheit, Hoffnung und menschliches Handeln.
Der Sinn entsteht nicht im Dauerhaften, sondern im Vergänglichen – im Bewusstsein, dass alles vergeht, und im Mut, dennoch Schönheit zu schaffen.