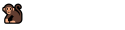Der Analogie-Schluss bei Schopenhauer
In dieser Arbeit geht es um den zentralen argumentativen Baustein des philosophischen Systems von Arthur Schopenhauer: Wie kommt Schopenhauer zum „Ding an sich als dem Zugrundeliegenden aller Erscheinungen“[1]? Oder anders gefragt: Welche Argumente stützen das „Fundament der Metaphysik Schopenhauers“[2]?
Zunächst: Was ist das philosophische System Schopenhauers? Welche zentralen Aussagen machen sein System aus?
Erstens: Die Welt mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Anorganischem und Naturkräften ist etwas Vorgestelltes. Diese Vorstellung (im Weiteren auch „Anschauung“ oder „Erscheinung“) wird notwendig räumlich, zeitlich und kausal erfahren. Der Verstand des Subjektes erschafft die vorgestellte Welt aus den sinnlichen Informationen, die bspw. Augen, Ohren oder Haut liefern.[3] Für dieses so erkennende Subjekt ist alles in der Vorstellung Objekt. Ohne den Verstand, ohne Subjekt ist die Welt nach Schopenhauer nicht denkbar. Dennoch ist die Vorstellung kein Schein,[4] aber mit dem Traum vergleichbar. Das Leben unterscheidet sich vom Traum im Schlaf dadurch, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen den Wachphasen gibt, während die Träume zwar auch eine raumzeitliche und kausale Struktur haben, aber nicht notwendig zusammenhängen. Das Leben ist, so könnte man sagen, ein langer zusammenhängender Traum.[5]
Zweitens: Die angeschaute Welt (Vorstellung) mit all ihren Objekten hat einen einzigen metaphysischen Kern, der Kants Ding an sich ist:[6]
„[…] ich habe dagegen als den Kern aller Wesen Das nachgewiesen was in uns der Wille ist, der erst in der animalischen Natur mit einem Intellekt ausgerüstet auftritt.“[7]
Wir sind nicht bloß erkennende Subjekte, sondern auch wollende Subjekte. Dieses Wollen identifiziert Schopenhauer als Kern allen Daseins. Nicht bloß Kern des eigenen Körpers (Leib-Wille-Identität), sondern in allen Objekten der Vorstellung sieht Schopenhauer einen Willen (Welt-Wille-Identität), der sich stets wollend, drängend, wünschend und strebend äußert.[8] Daher stammt alles Leid der Welt:[9]
„Sahen wir schon in der erkenntnißlosen Natur das innere Wesen derselben als ein beständiges Streben, ohne Ziel und ohne Rast; so tritt uns bei der Betrachtung des Thieres und des Menschen dieses noch viel deutlicher entgegen. Wollen und Streben ist sein ganzes Wesen, einem unlöschbaren Durst gänzlich zu vergleichen. Die Basis alles Wollens aber ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz, dem er folglich schon ursprünglich und durch sein Wesen anheimfällt. Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn furchtbare Leere und Langeweile: d.h. sein Wesen und sein Daseyn selbst wird ihm zur unerträglichen Last. Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langenweile, welche beide in der That dessen letzte Bestandtheile sind.“[10]
Drittens: Einen kurzfristigen Ausweg sieht Schopenhauer in der Kunst.[11] Und im Mitleid sieht Schopenhauer einen möglichen Pfad zur Erlösung.[12]
Diese Arbeit soll nun darlegen, wie Schopenhauer, ausgehend von der Leib-Wille-Identität zum Schluss der Welt-Wille-Identität kommt bzw. für diese argumentiert. Einerseits scheint Schopenhauer einen Analogieschluss dafür gewählt zu haben.[13] Dieser findet sich in § 19 im ersten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung (W I, auch als Hauptwerk bezeichnet). Zu untersuchen ist, ob Schopenhauer einen weiteren argumentativen Weg dazu anbietet.
Im ersten Teil soll es um den Analogieschluss gehen. Es wird dargelegt, was ein Analogieschluss ist, wie er aufgebaut ist und was einen solchen Schluss überzeugend macht. Außerdem wird dargestellt, wie man einen Analogieschluss bewertet.
Darauf folgt die Einordnung des Analogieschlusses von Schopenhauer in § 19 von Die Welt als Wille und Vorstellung. Dieses Argument wird rekonstruiert und diskutiert. Außerdem wird dargestellt, wie diese Textstelle in der Literatur behandelt wird. Mit Blick auf die Kriterien von Analogieschlüssen wird anschließend überprüft, inwieweit ein Analogieschluss in Schopenhauers philosophischem System überhaupt die gewünschte Funktion erfüllen kann.
Im zweiten Teil geht es um Mitleid als Form der Erkenntnis und andere mögliche argumentative Alternativen zum Analogieschluss, wie die Kunst und Schopenhauers Darstellungen zum Willen in der Natur, in denen er sich auf zeitgenössische naturwissenschaftliche Erkenntnisse bezog und darin seine Philosophie bestätigt sah.
Im dritten Teil wird thematisiert, inwiefern Schopenhauer überhaupt für die Welt-Wille-Identität argumentieren kann. Zusätzlich wird diskutiert, ob die argumentative Last von verschiedenen Teilen seines Werkes gemeinsam getragen wird. Schließlich muss noch untersucht werden, inwiefern bloß von einer metaphysischen Deutung gesprochen werden kann und was Schopenhauers Anspruch an seine Argumente ist.
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil: Analogieschluss
- Zweiter Teil: Alternative Argumente
- Dritter Teil: Unbelegbare kohärente Deutung?
- Fazit
- Literatur
Erster Teil: Analogieschluss
Was ist ein Analogieschluss?
Struktur und Kriterien
Der Analogieschluss ist ein induktiver Schluss wie bspw. die statistische Induktion oder die kausale Induktion.[14] Er steht im Gegensatz zum deduktiven Schluss. Dieser schließt, sofern man die Prämissen akzeptiert, mit Sicherheit vom Allgemeinen auf das Einzelne und jener folgert aus dem Einzelnen auf das Allgemeine und ist mit Unsicherheit verbunden. Induktiv abgeleiteten Aussagen kann man, sofern man die Prämissen akzeptiert, bestenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Wahrheit zusprechen.
Dass eine Analogie zu den induktiven Schlüssen gezählt wird,[15] mag insbesondere Goethe-Kennern[16] fremd wirken. Das Unbehagen ist allerdings auflösbar, wenn man von der statistischen Induktion als der Induktion im engeren Sinne spricht und andere o.g. Schlüsse als induktive Schlüsse im weiteren Sinne auffasst. Goethe stellte die Analogie der Induktion (im engeren Sinne) entgegen, da erstere mehrere Fälle betrachtet, ohne dabei eine allgemeine Regel aufzustellen.[17]
Die Anwendung eines Analogieschlusses, bedeutet aus der Erkenntnis, dass Gegenstände in einer gewissen Weise gleich sind, zu schließen, dass sie wahrscheinlich auch in einer anderen Weise gleich sind. Ein typischer Anwendungsfall für diese Schlussart ist das Problem des Fremdpsychischen: Wenn mein Gegenüber sich so verhält wie ich, und ich dabei einen bestimmten mentalen Zustand habe, dann schließe ich daraus, dass mein Gegenüber wahrscheinlich denselben mentalen Zustand hat.[18]
Der Analogieschluss hat demnach die Form:
Prämisse 1: A ist B ähnlich.
Prämisse 2: A ist w.
Konklusion: B ist w.[19]
Doch was macht die Ähnlichkeit zwischen zwei Dingen, Sachverhalten bzw. Entitäten aus?
Wenn, wie Goethe meinte, jedes Existierende zu allem Existierenden ein Analogon ist,[20] oder zwischen zwei Entitäten recht einfach ein Merkmal mit größerer Überzeugungskraft konstruierbar ist, muss ein genauerer Blick auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Entitäten geworfen werden, da sonst alles allem in einer Eigenschaft gleicht und in der Folge auch in anderen. Eine Balance zwischen „Ganzheits- und Differenzdenken“[21] bzw. ein schärferer Blick auf die Struktur von Analogieschlüssen ist notwendig.
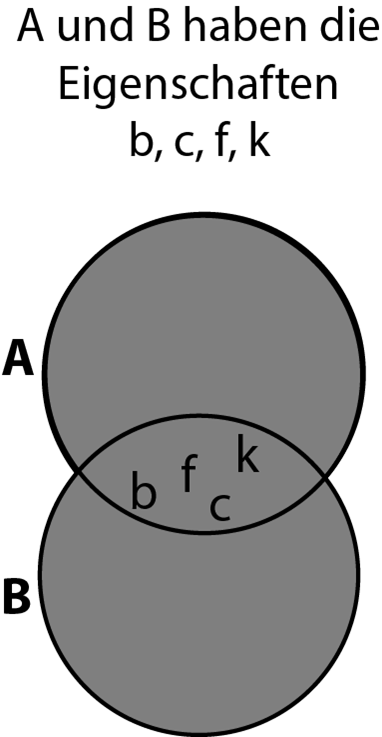
|
Abbildung 1: Gemeinsame Eigenschaften von A und B (nach Stan Baronett: Logic, 322f.) |
Mit dem Analogieschluss betrachtet man zwei Objekte und ihre Eigenschaften. Die in der ersten Prämisse gegebene Ähnlichkeit kann über eine Anzahl von Eigenschaften gegeben sein, die beide Objekte teilen. In Abbildung 1 haben die Objekte A und B die Eigenschaften b, c, f und k gemeinsam und können daher als ähnlich betrachtet werden. Zu beachten ist hierbei, dass weitere eventuelle Eigenschaften der Objekte A und B vorerst unberücksichtigt bleiben.
Prämisse 2 führt ein weiteres Prädikat ein, von dem nur bekannt ist, dass es A zukommt. Abbildung 2 zeigt die daraus resultierende Problematik, die deduktiv nicht zu lösen ist.
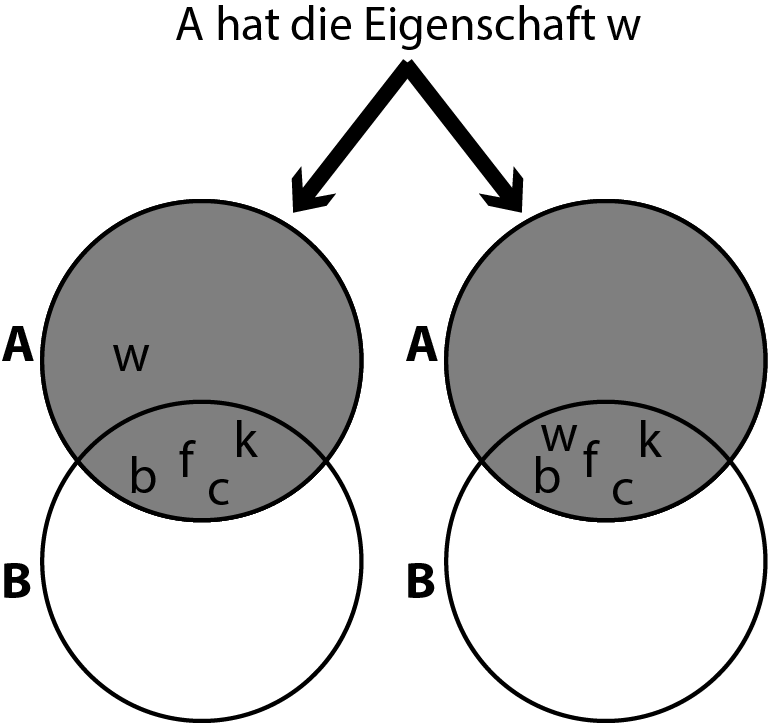
|
Abbildung 2: Eigenschaft von A (nach Stan Baronett: Logic, 322f.) |
Die in der zweiten Prämisse eingeführte Eigenschaft w ist eine Eigenschaft von A, aber nicht zwingend auch von B. Aus der in P1 gegebenen Ähnlichkeit, die anhand der Vielzahl der geteilten Eigenschaften von A und B dokumentiert ist, folgt die Konklusion (unter dem rechten Pfeil) des Analogieschlusses, dass also auch w eine Eigenschaft von B ist. Sicher ist das nicht, aber es gibt eine gewisse, möglicherweise hohe Wahrscheinlichkeit. Diese liegt zwischen dem Schließen auf ein Konjunkt (p ∧ q → p) und dem Schließen auf ein Disjunkt (p ∨ q → p).
Was macht einen Analogieschluss stärker? Zum einen erscheint ein Analogieschluss stärker, wenn die Anzahl der gemeinsamen Eigenschaften größer ist. Wenn zwei Objekte A und B zehn gemeinsame Eigenschaften haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie weitere gemeinsame Eigenschaften haben, als wenn sie bloß eine Gemeinsamkeit haben. Eine andere Möglichkeit ist, noch mehr Objekte (C, D, …) anzuführen, die die geteilten Eigenschaften von A und B haben und dazu noch die für B fragliche Eigenschaft w haben. Eine solche Analogie wird nochmals gestärkt, wenn die Objekte A, C und D sich in anderen Eigenschaften stark voneinander unterscheiden. Die vierte Möglichkeit, einen Analogieschluss zu stärken, ist eine für die Konklusion erhöhte Relevanz der Eigenschaften, die die in P1 etablierte Ähnlichkeit ausmachen.[22] Ein Objekt P kann rot und laut sein, wie das Objekt F, welches zusätzlich die Eigenschaft hat, schnell zu fahren. P könnte ein Porsche-Diesel-Traktor sein und die Eigenschaften der Farbe und Lautstärke haben für die Geschwindigkeit keine Relevanz. Eine hohe Qualität hat der Analogieschluss also durch eine größere Anzahl von verschiedenartigen Objekten die mit einem weiteren Objekt bis auf eine Eigenschaft viele relevante teilen.[23]
Möglichkeiten der Bewertung von Analogieschlüssen
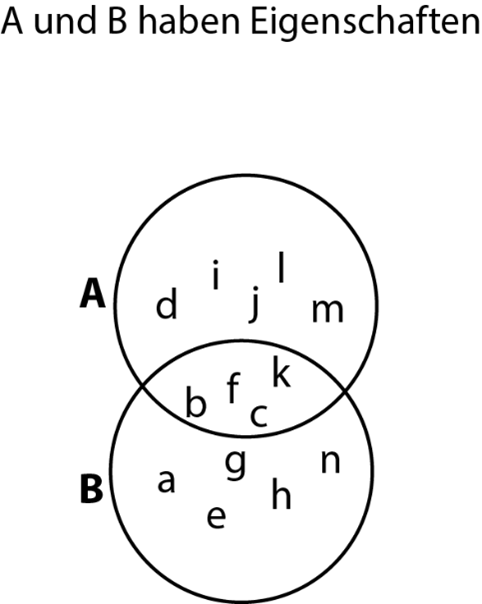
|
Abbildung 3: Eigenschaften von A und B (nach Stan Baronett: Logic, 331f.) |
Es gibt zwei Arten der Evaluation von Analogieschlüssen:[24] Erstens gibt es die Disanalogie, bei welcher die in Abbildung 1 unberücksichtigten Eigenschaften, nach denen sich A und B unterschieden haben, betrachtet werden.
Wenn mit Blick auf das in Abbildung 3 vollständigere Bild aus den Gemeinsamkeiten von A und B (b, c, f, k) die Eigenschaft d von A per Analogieschluss auch für B angenommen wird, dient der Verweis auf Eigenschaften, die bspw. B hat und A nicht (a, e, g, h, n), dazu, die Analogie zu verwerfen.
„Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden, daher erscheint uns das Dasein immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche. In beiden Fällen stagniert die Betrachtung, einmal als über-lebendig, das andere Mal als getötet.“[25]
Mit diesem Zitat erklärt Goethe plausibel die Gefahren von Analogien, vereinfacht allerdings etwas: Liegt der Fokus auf den Unterschieden zerfällt die Analogie, während alles analog zu allem erscheint, wenn Gemeinsamkeiten betrachtet werden. Aber: Hier gilt wieder, was zu den Kriterien guter Analogieschlüsse zählte: Eine Disanalogie ist stärker, wenn es viele und vor allem relevante Unterschiede zwischen A und B gibt.[26]
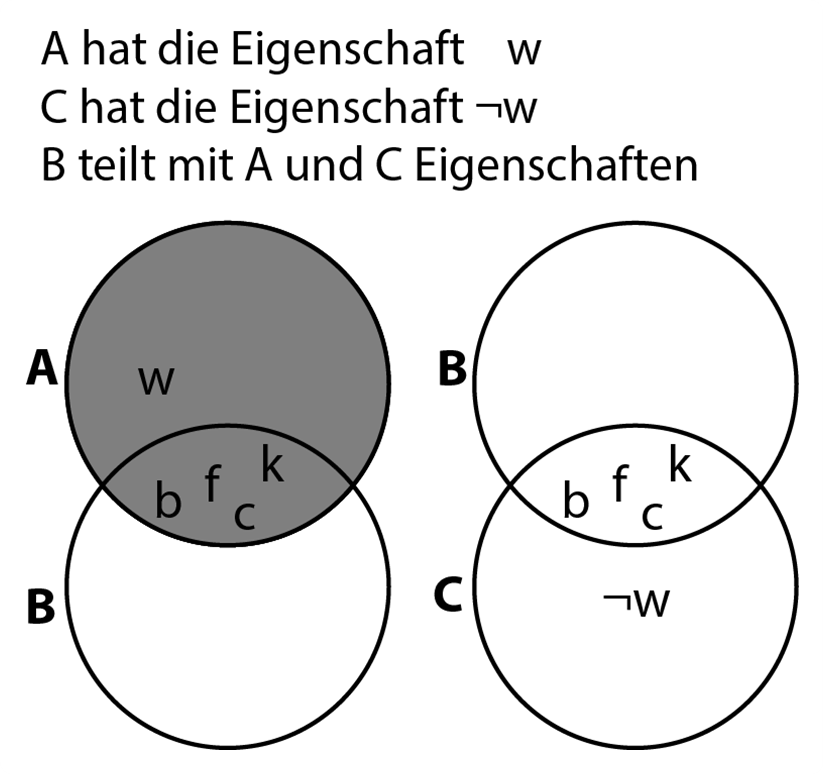
|
Abbildung 4: Eigenschaften von A, B und C (nach Stan Baronett: Logic, 332.) |
Die Gegenanalogie ist ein zweites Mittel zur Überprüfung einer Analogie: Die Menge von Eigenschaften, die A und B teilen und die als Grundlage für die Zuschreibung der Eigenschaft w dient, könnte auch C teilen, auf das w nicht zutrifft, sondern explizit nicht-w.
Diese Gegenanalogie (Abbildung 4) entkräftet die erste zwischen A und B, da eine weitere und gleichwertige Analogie zwischen B und C dagegensteht, die mit der gleichen Ähnlichkeit (Eigenschaften b, c, f, k) die entgegengesetzte Aussage stützt.
Zusammenfassung
Ein Analogieschluss benötigt mindestens zwei Entitäten und mindestens zwei Prädikate, von denen eines sicher beiden Entitäten zukommt, während das zweite Prädikat nur bei einer Entität sicher gegeben ist. Aufgrund der Ähnlichkeit, die sich auf die eine gemeinsame Eigenschaft stützt, schreibt man mit dem Analogieschluss das zweite Prädikat auch der anderen Entität zu. Zu berücksichtigen ist beim Analogieschluss zweierlei: Erstens sollte man alle relevanten Eigenschaften der Entitäten berücksichtigen und findet dabei neben Gemeinsamkeiten mitunter auch Unterschiede. Zweitens gibt es möglicherweise auch Entitäten, die ebenfalls die Gemeinsamkeiten teilen, aber sich anderweitig unterscheiden.
Schopenhauers Analogieschluss in § 19 W I
Rekonstruktion des Arguments
Arthur Schopenhauers Analogieschluss in § 19 von Die Welt als Wille und Vorstellung nimmt in diesem Werk eine zentrale Funktion ein. Vom eigenen Leib wird auf die alle anderen Weltwesen geschlossen.[27] Sein argumentativer Weg ist es, die Welt aus dem Menschen heraus zu verstehen, und das Unbekannte aus dem Bekannten heraus zu verstehen.[28] So schließt Schopenhauer aus der Leib-Wille-Identität auf die Welt-Wille-Identität.[29] Im Folgenden wird zuerst dargestellt, was Schopenhauer für den Analogieschluss voraussetzt, dann wird der Analogieschluss rekonstruiert und schließlich untersucht, was Schopenhauer damit erreichen will.
Schopenhauer beginnt sein Hauptwerk damit, an Kant anzuschließen und betrachtet „alle irgend vorhandenen Objekte, ja sogar den eigenen Leib“[30] als bloße Vorstellung. Diese Objekte sind Materie und setzen demnach Raum und Zeit voraus, da keine Veränderung ohne Zeit möglich ist und keine Ausdehnung ohne Raum.[31] Unter allen Objekten gibt es nach Schopenhauer noch den Leib bzw. Leiber. Die eigenen Leiber sind für Subjekte Objekte, die sich durch eine Sensibilität auszeichnen, und Sinneseindrücke liefern.[32]
Im nächsten Schritt führt Schopenhauer den individuellen Willen, den Individuen in sich spüren, ein und zeigt, dass eine Leib-Wille-Identität viele Phänomene erklären kann. Einerseits sieht das Individuum seinen Leib als ein Objekt unter Objekten, andererseits ist dem Individuum der eigene Wille wahrnehmbar. Bewegungen des eigenen Leibes sind in zwei völlig verschiedener Weise wahrnehmbar: Einerseits kann bspw. die Bewegung der eigenen Hand wie die Bewegung anderer Objekte anschaulich betrachtet werden, andererseits ist der Willensakt ganz unmittelbar wahrnehmbar. [33] Diese beiden Weisen sind nach Schopenhauer nicht kausal verknüpft, sondern sie sind „Eines und das Selbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben“[34] und können am eigenen Leib nicht getrennt sein: Man will nichts wirklich, außer man tut es; alles andere sind „bloße Ueberlegungen der Vernunft, über das, was man dereinst wollen wird“[35]. Die Identität von Leib und Wille zeige sich nicht nur daran, dass echtes Wollen und Thun eins sind,[36] sondern auch daran, dass Affekte und Leidenschaften nicht nur geistige Phänomene sind, sondern auch unmittelbar den Leib berühren.[37] Dazu führt er
„das beschleunigte Herzklopfen bei Freude oder Furcht, das Erröthen bei der Beschämung, Erblassen beim Schreck […], Weinen bei der Betrübniß, […] Speichel im Munde bei erregter Leckerheit […]“[38]
und andere ähnliche Phänomene an, die geistig und körperlich zugleich sind.
Vom eigenen Willen hat man, so Schopenhauer, unmittelbar Kenntnis:
„Wem nun, durch alle diese Betrachtungen, auch in abstracto, mithin deutlich und sicher, die Erkenntniß geworden ist, welche in concreto Jeder unmittelbar, d.h. als Gefühl besitzt, daß nämlich das Wesen an sich seiner eigenen Erscheinung, welche als Vorstellung sich ihm sowohl durch seine Handlungen, als durch das bleibende Substrat dieser, seinen Leib, darstellt, sein Wille ist, der das Unmittelbarste seines Bewußtseyns ausmacht, als solches aber nicht völlig in die Form der Vorstellung, in welcher Objekt und Subjekt sich gegenüber stehen, eingegangen ist; sondern auf eine unmittelbare Weise, in der man Subjekt und Objekt nicht ganz deutlich unterscheidet, sich kund giebt, jedoch auch nicht im Ganzen, sondern nur in seinen einzelnen Akten dem Individuo selbst kenntlich wird: - wer, sage ich, mit mir diese Ueberzeugung gewonnen hat, dem wird sie, ganz von selbst, der Schlüssel werden zur Erkenntniß des innersten Wesens der gesammten Natur, indem er sie nun auch auf alle jene Erscheinungen überträgt, die ihm nicht, wie seine eigene, in unmittelbarer Erkenntniß neben der mittelbaren, sondern bloß in letzterer, also bloß einseitig, als Vorstellung allein, gegeben sind“[39]
Diese Kenntnis ist dennoch nie eine vollständige und zudem keine vom Leib getrennte (das ist für Schopenhauer auch nicht vorstellbar). Den eigenen Willen erfahre man nur in Akten in der Form der Zeit. Ebenso ist auch der Leib erfahrbar.[40]
Leib und Wille gehören demnach zusammen, da das, was heute Gegenstand der akademischen Psychologie ist, das Erleben und Verhalten,[41] wie Schopenhauer in Beispielen zeigt, untrennbar in Willen und Leib erfahrbar ist.
Die Leib-Wille-Identität bezeichnet Schopenhauer als unbeweisbar („hingegen kann sie ihrer Natur nach niemals bewiesen […] werden“[42]). Allerdings möchte Schopenhauer für diese Sichtweise weiter argumentieren.[43] Bis dahin hat er die Leib-Wille-Identität, die er als wichtigste Erkenntnis und Ausgangspunkt betrachtet, beispielsweise mit „Ferner zeigt sich Identität des Leibes und Willens […]“[44] lediglich veranschaulicht. Das erkennende Subjekt ist bei Schopenhauer ein Ding an sich,[45] kann nicht Objekt sein und erkannt werden:
„Das Ding an sich kann, eben als solches, nur ganz unmittelbar ins Bewußtseyn kommen, nämlich dadurch, daß es selbst sich seiner bewußt wird: es objektiv erkennen wollen, heißt etwas Widersprechendes verlangen.“[46]
Dies ist nun der Ausgangspunkt für den Analogieschluss: Die Identität von individuellem Leib mit individuellem Willen,[47] bzw. der Satz, dass der eigene Leib die Objektität des eigenen Willens ist.[48] Die Leib-Wille-Identität bindet den Willen des Subjekts an das Objekt in der Vorstellung, den das Subjekt als eigenen Leib identifiziert.
Obwohl Schopenhauer es erst in den späteren Paragraphen (§§ 21–23) klar ausdrückt, steht für ihn systematisch schon vor dem Analogieschluss fest, dass er über den individuellen Willen das Ding an sich ausmacht. Das ergibt sich aus zwei Tatsachen: Erstens beruft Schopenhauer sich in den genannten nachfolgenden Paragraphen über den metaphysischen Willen nicht auf den Analogieschluss und zweitens schreibt er in § 19 immer wieder explizit, dass man das „an sich“ einer Erscheinung, nämlich des Leibes, bereits kenne. Der Analogieschluss hat damit „lediglich“ die Aufgabe, zu klären, was es mit den anderen Erscheinungen auf sich hat (bzw. ob sie etwas an sich sind). Im Folgenden geht es also, anders gesagt, um den Schritt von der Leib-Wille-Identität zur Welt-Wille-Identität.
In § 19 stellt Schopenhauer den Leib des erkennenden Subjekts in der Vorstellung anderen Objekten gleich. Der eigene Leib, bspw. die eigene Hand, und andere Objekte der Anschauung, wie Mitmenschen, andere Tiere, Pflanzen oder Steine, sind allesamt in der Vorstellung, also anschaulich gegeben, materiell in der Raumzeit. Im Unterschied zum Leib können die anderen Objekte nicht innerlich als Wille erfahren werden (Leib-Wille-Identität).
„so ist es uns nunmehr deutlich geworden, was im Bewußtseyn eines Jeden, die Vorstellung des eigenen Leibes von allen anderen, dieser übrigens ganz gleichen, unterscheidet, nämlich dies, daß der Leib noch in einer ganz andern, toto genere verschiedenen Art im Bewußtseyn vorkommt, die man durch das Wort Wille bezeichnet, und daß eben diese doppelte Erkenntniß, die wir vom eigenen Leibe haben, uns über ihn selbst, über sein Wirken und Bewegen auf Motive, wie auch über sein Leiden durch äußere Einwirkung, mit Einem Wort, über das, was er, nicht als Vorstellung, sondern außerdem, also an sich ist, denjenigen Aufschluß giebt, welchen wir über das Wesen, Wirken und Leiden aller andern realen Objekte unmittelbar nicht haben.“[49]
Schopenhauer steht vor der Wahl: Einerseits sieht er die Möglichkeit des Solipsismus. Da außerhalb des Ichs des Subjekts, des eigenen Willens, kein Zugang möglich ist, könnte man den Standpunkt des Solipsismus einnehmen. Andererseits könnte man anderen Objekten ein inneres Wesen zugestehen.[50]
„Bringt nun also unsere stets an Individualität gebundene und eben hierin ihre Beschränkung habende Erkenntniß es nothwendig mit sich, daß Jeder nur Eines seyn, hingegen alles andere erkennen kann, welche Beschränkung eben eigentlich das Bedürfniß der Philosophie erzeugt; so werden wir, die wir eben deshalb durch Philosophie die Schranken unserer Erkenntniß zu erweitern streben, jenes sich uns hier entgegenstellende skeptische Argument des theoretischen Egoismus ansehen als eine kleine Gränzfestung, die zwar auf immer unbezwinglich ist, deren Besatzung aber durchaus auch nie aus ihr herauskann, daher man ihr vorbeigehen und ohne Gefahr sie im Rücken liegen lassen darf.“[51]
Motivation für die Wahl der zweiten Möglichkeit ist also der Wunsch, die Schranken der Erkenntnis zu erweitern. Die erste Option ist unwiderlegbar, führt nach Schopenhauer allerdings ins Leere und die Untersuchung endet erkenntnislos. Die zweite Option ist eine, die positiv nicht belegbar ist, aber eine Erklärung bieten kann. Zudem kann sie sich jederzeit durch innere Widersprüche als falsch erweisen. Zur zweiten Option zu greifen ist in dem Sinne also wie ein Experiment anzusehen.
Zum Verständnis aller Objekte, die nicht unser Leib sind, will Schopenhauer nun das innere Wesen des Subjekts gebrauchen. Was wir in uns Willen nennen, ist nach Schopenhauer das innere Wesen des Subjekts. Dies macht zusammen die „doppelte Leibeserfahrung“[52] aus. Dies nimmt er als „Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur“[53]
Der eigentliche Analogieschluss ist demnach kein Analogieschluss, sondern eine Setzung. Die anderen Objekte werden so angesehen, wie das dem Subjekt in besonderem Maße (unmittelbar) zugängliche Objekt (Leib), weil dem Subjekt keine alternative Betrachtungsweise vorliegt. Die Welt setze sich dem Subjekt eben nur aus Vorstellung und Wille zusammen:
„Wir werden demzufolge die nunmehr zur Deutlichkeit erhobene doppelte, auf zwei völlig heterogene Weisen gegebene Erkenntniß, welche wir vom Wesen und Wirken unseres eigenen Leibes haben, weiterhin als einen Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener Leib, daher nicht auf doppelte Weise, sondern allein als Vorstellungen unserm Bewußtseyn gegeben sind, eben nach Analogie jenes Leibes beurtheilen und daher annehmen, daß, wie sie einerseits, ganz so wie er, Vorstellung und darin mit ihm gleichartig sind, auch andererseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstellung des Subjekts bei Seite setzt, das dann noch übrig Bleibende, seinem innern Wesen nach, das selbe seyn muß, als was wir an uns Wille nennen. Denn welche andere Art von Daseyn oder Realität sollten wir der übrigen Körperwelt beilegen? woher die Elemente nehmen, aus der wir eine solche zusammensetzten? Außer dem Willen und der Vorstellung ist uns gar nichts bekannt, noch denkbar.“[54]
In dem Sinne ist der „Analogieschluss“ ein Schluss auf die beste Erklärung:
„The inference to the best explanation is the view that once we can select the best of any competing explanations of an event, then we are justified in accepting it, or even believing it.“[55]
Für die Phänomene, die Schopenhauer untersucht, hat er genau eine Erklärung und meint, dass uns nichts anderes bekannt oder überhaupt denkbar ist. Also geht er von dieser Erklärung aus.
Anstelle eines Analogieschlusses, wie er mit Abbildung 5 denkbar wäre, geht Schopenhauer also folgende zwei Schritte: Erstens wählt er anstelle eines logisch unproblematischen Solipsismus den Weg, bei anderen Objekten von einem inneren Wesen, einem „an sich“[56] auszugehen. Zweitens nimmt Schopenhauer für das innerste Wesen, das „an sich“, ihr Sein außer der Vorstellung, die beste Erklärung, die er hat, nämlich das ihm „einzig bekannte“, den Willen.
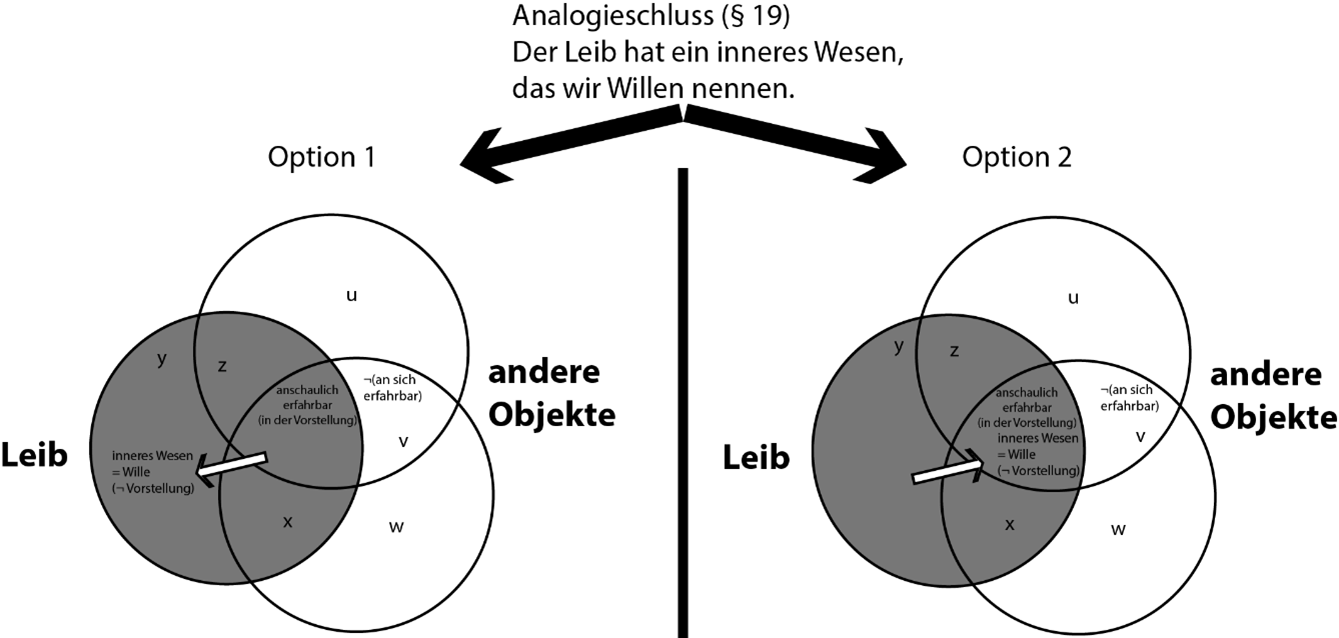
|
Abbildung 5: "Wille" als Eigenschaft des Leibes und auch anderer Objekte? |
Schopenhauer schließt nicht einfach aufgrund der Ähnlichkeit der Objekte in der Vorstellung auf innere Wesen, wie Abbildung 5 zeigt. Dieser Schritt wäre, wie weiter unten noch gezeigt wird, auch nicht sehr überzeugend.
Das Resultat der zwei vorgestellten Schritte ist für Schopenhauer also zunächst „eine Vielzahl von Individualwillen“ [57], die jeweils das innere Wesen anderer Objekte ausmachen. Jedes Objekt ist also zweifach gegeben, einmal in der Vorstellung und einmal als Ding an sich, welches er Willen nennt. Doch wendet Schopenhauer diese Erklärung nicht willkürlich an: Menschen, Tiere, Pflanzen und Steine zeigen sich eben in unterschiedlichen Graden der Objektität, als ein Kontinuum der Erscheinungen,[58] das er analog auf die sie betreffenden Ursachen bezieht. So kann er sagen, dass ein Stein zwar nicht auf Motive reagiert, wie Menschen auf Motive reagieren,[59] aber dennoch mit der gleichen Notwendigkeit.
Im Anschluss an den sogenannten Analogieschluss baut Schopenhauer darauf auf und schreibt explizit in § 21, dass der individuelle Wille und das Ding an sich eines sind und allen Erscheinungen dasselbe Ding an sich zugrunde liegt:
„diese Alle nur in der Erscheinung für verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als das Selbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar so intim und besser als alles Andere Bekannte, was da, wo es am deutlichsten hervortritt, Wille heißt. Diese Anwendung der Reflexion ist es allein, welche uns nicht mehr bei der Erscheinung stehen bleiben läßt, sondern hinüberführt zum Ding an sich. Erscheinung heißt Vorstellung, und weiter nichts: alle Vorstellung, welcher Art sie auch sei, alles Objekt, ist Erscheinung. Ding an sich aber ist allein der Wille: als solcher ist er durchaus nicht Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektität ist. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und ebenso des Ganzen: er erscheint in jeder blindwirkenden Naturkraft: er auch erscheint im überlegten Handeln des Menschen; welcher beiden große Verschiedenheit doch nur den Grad des Erscheinens, nicht das Wesen des Erscheinenden trifft.“[60]
Während bei Kant das Ding an sich eine Bezeichnung ist, die die Subjektunabhängigkeit hervorhebt,[61] sieht Schopenhauer im Unterschied dazu unter den Erscheinungen eine, den Leib nämlich, der einen besonderen Zugang hat. Der eigene Wille ist das Ding an sich. Dieser Schritt ist etwas problematisch, da das Ding an sich, wie Schopenhauer schreibt, außerhalb der Vorstellung und ihren Formen ist, zu denen Raum, Zeit und Kausalität gehören. Wie gelangen wir allerdings zur Kenntnis unseres inneren Wesens? Den eigenen Willen erfährt man nur in Akten in der Form der Zeit, genauso wie der Leib erfahrbar ist.
„Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einheit, nicht vollkommen seinem Wesen nach, sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Akten, also in der Zeit, welche die Form der Erscheinung meines Leibes, wie jedes Objekts ist“[62]
Ist der Individualwille, den wir wahrnehmen, nicht also auch in der Vorstellung, da es ein zeitlicher Zugang ist? Ist der Wille dann nicht nur ein inneres Wesen in dem Sinne, dass es einen privilegierten Zugang zu ihm gibt, nämlich des Individuums selbst? Der Zugang zum Willen ist zeitlich und dieser ist auch nach Schopenhauer Erscheinung und Objekt.
„[…] Namen und Begriff von einem Objekt borgen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folglich von ei-ner seiner Erscheinungen: aber diese durfte, um als Verständigungspunkt zu dienen, keine andere seyn, als unter allen seinen Erscheinungen die vollkommenste, d.h. die deutlichste, am meisten entfaltete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: diese aber eben ist des Menschen Wille […]“[63]
Wenn man den Analogieschluss mitgeht, hat man lediglich ein Inneres, eine Innenperspektive anderer Objekte erhalten, aber nicht das Ding an sich aller Objekte oder auch nur die Dinge an sich.
Da ohne Raum und Zeit weder Nebeneinander noch Nacheinander möglich ist, wie Schopenhauer in seiner Dissertation ausführt,[64] und dem Ding an sich diese Formen nicht zukommen,[65] kann dem Ding an sich keine Vielheit zukommen. Auch Kant argumentiert dafür, dass die Dinge an sich nicht in Raum und Zeit sind.[66] Schopenhauer schließt eben daraus mit diesem Argument auch darauf, dass weder Nebeneinander noch Nacheinander und somit auch keine Vielheit möglich ist:
„Denn Zeit und Raum allein sind es, mittelst welcher das dem Wesen und dem Begriff nach Gleiche und Eine doch als verschieden, als Vielheit neben und nach einander erscheint: sie sind folglich das principium individuationis […]“[67]
Schopenhauer schließt aus der Negation der Vielheit, dass es einen Willen gibt, bleibt allerdings vage darüber, was das bedeutet: Einerseits liegt der metaphysische Wille außerhalb der Möglichkeit von Vielheit, andererseits ist er nicht numerisch eins. Der Wille ist quantitativ nicht bestimmbar:
„Der Wille als Ding an sich liegt, dem Gesagten zufolge, außerhalb des Gebietes des Satzes vom Grund in allen seinen Gestaltungen, und ist folglich schlechthin grundlos, obwohl jede seiner Erscheinungen durchaus dem Satz vom Grunde unterworfen ist: er ist ferner frei von aller Vielheit, obwohl seine Erscheinungen in Zeit und Raum unzählig sind: er selbst ist Einer: jedoch nicht wie ein Objekt Eines ist, dessen Einheit nur im Gegensatz der möglichen Vielheit erkannt wird: noch auch wie ein Begriff Eins ist, der nur durch Abstraktion von der Vielheit entstanden ist: sondern er ist Eines als das, was außer Zeit und Raum, dem principio individuationis, d.i. der Möglichkeit der Vielheit, liegt.“[68]
Dieses universale und quantitativ nicht bestimmbare Ding an sich nennt Schopenhauer in Anlehnung an etwas Ähnliches, das wir kennen und benennen: Wille.
„Dieses Ding an sich (wir wollen den Kantischen Ausdruck als stehende Formel beibehalten), welches als solches nimmermehr Objekt ist, eben weil alles Objekt schon wieder seine bloße Erscheinung, nicht mehr es selbst ist, mußte, wenn es dennoch objektiv gedacht werden sollte, Namen und Begriff von einem Objekt borgen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folglich von einer seiner Erscheinungen: aber diese durfte, um als Verständigungspunkt zu dienen, keine andere seyn, als unter allen seinen Erscheinungen die vollkommenste, d.h. die deutlichste, am meisten entfaltete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: diese aber eben ist des Menschen Wille. Man hat jedoch wohl zu bemerken, daß wir hier allerdings nur eine denominatio a potiori gebrauchen, durch welche eben deshalb der Begriff Wille eine größere Ausdehnung erhält, als er bisher hatte. […] Nun aber bezeichnet das Wort Wille, welches uns, wie ein Zauberwort, das innerste Wesen jedes Dinges in der Natur aufschließen soll, keineswegs eine unbekannte Größe, ein durch Schlüsse erreichtes Etwas; sondern ein durchaus unmittelbar Erkanntes und so sehr Bekanntes, daß wir, was Wille sei, viel besser wissen und verstehen, als sonst irgend etwas, was immer es auch sei.“[69]
Also benennt Schopenhauer das Ding an sich nach dem, was wir in uns als Inneres (Mentales, Psychisches) wahrnehmen können, nach dem individuellen Willen.
Das Erfahren von sinnlichen und mentalen Elementen im Bereich der Vorstellung, das Schopenhauer zur Leib-Wille-Identität führte, wurde somit zu einem metaphysischen Problem, in dem er von der mentalen auf die metaphysische Dimension spekuliert.[70] Die zwei Betrachtungsweisen der Welt, die völlig verschiedener Art sind,[71] gehen deutlich über die eigentlichen Objekte des Analogieschlusses hinaus, der im Kern den „theoretischen Egoismus“[72] bzw. das Problem des Fremdpsychischen behandelt: Haben andere Objekte der Vorstellung auch eine mentale Dimension (Erleben, Verhalten)?
Rezeption des Analogieschlusses
Im folgenden Abschnitt soll dreierlei gezeigt werden. Erstens soll mit diesem Überblick zur Rezeption des Analogieschlusses gezeigt werden, dass, wie bereits mehrfach behauptet, der Analogieschluss eine zentrale Stelle in der Philosophie Schopenhauers ist. Zweitens soll dargestellt werden, welche Probleme an dieser Stelle identifiziert werden. Und drittens bieten einige der aufgeführten Autoren Anhaltspunkte für eine Einordnung des Analogieschlusses in die Argumentationsstrategie Schopenhauers.
Booms nennt den Analogieschluss „billig“[73] und meint, dieser sei „offensichtlich aus der Not geboren“[74]. Außerdem habe sich Schopenhauer zuvor längst entschieden und Alternativen nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Stattdessen müsste man von Setzungen sprechen.[75]
Ciracì spricht nicht von einem „Analogieschluss“, sondern von „Analogie“ und vielmehr von „Analogiemethode“. Diese sei bei Schopenhauer kein „dogmatisches Prinzip“, sondern sie wirke gegen den theoretischen Egoismus. Die Analogiemethode beruhe auf zwei Schlüssen, nämlich der Identifikation von Leib mit Willen, und der Ausweitung dieser Identifikation auf die anderen Wesen.[76]
Wie bereits dargestellt, wirkt der sog. Analogieschluss allerdings nicht gegen den theoretischen Egoismus, sondern ist der Schritt nach der bewussten Entscheidung gegen ihn. Schopenhauer identifiziert Leib mit Willen, erkennt, dass andere Objekte äußerlich Objekte wie der eigene Leib sind und stockt dann an den Grenzen des Satzes vom zureichenden Grunde des Erkennens:[77]
„[…] so ist man hiemit immer noch im Gebiet der bloßen Vorstellung, für die allein das Gesetz der Kausalität gilt, und über welches hinaus es nie führen kann.“[78]
Hier entscheidet er sich, um „Schranken unserer Erkenntniß zu erweitern“[79], gegen den theoretischen Egoismus. Erst nach dieser Entscheidung beantwortet Schopenhauer die Frage nach dem Fremdpsychischen mit dem Schluss auf die beste Erklärung und bewertet dafür andere Objekte analog zu seinem Leib. Dieses Verfahren könnte man insofern als Mittel gegen den theoretischen Egoismus werten, als dass damit andere Objekte nicht als Black Box verstanden werden müssten, sondern möglicherweise eine pragmatische Lösung für den Umgang mit anderen Objekten (insb. solche mit Verstand), da man deren Verhalten antizipieren könnte.
Friedhelm Decher sieht Schopenhauers Analogie in § 19 W I als eine für ihn notwendige Annahme, weil für Schopenhauer nichts anderes gegeben ist als Wille und Vorstellung.[80] Schopenhauer musste daher alle Objekte der Vorstellung wie den Leib betrachten und damit den Willen als Ding an sich aller Objekte ansehen.[81] Demnach ist der Analogieschluss nicht nur formal kein Analogieschluss, sondern nimmt in der argumentativen Folge für Decher eine nachgeordnete Stellung ein. Zuerst argumentiert Schopenhauer für die Elemente der Welt, Wille und Vorstellung, findet den Zugang dazu im Subjekt und stellt die notwendige Analogie in der Folge als ein vermeintliches Argument davor. Demnach wurde nach Decher beispielsweise nicht der Anwendungsbereich des Willensausdruckes mit dem Analogieschluss ausgedehnt, wie Hallich am Rande schreibt,[82] sondern er war bereits ausgedehnt und eine Analogie wurde damit bereits vorausgesetzt.
Dobrzański sieht das Subjekt ausgehend von der Leib-Wille-Identität vor zwei Möglichkeiten gestellt: Erstens könne es annehmen, dass die anderen Objekte der Vorstellung Objekte wie sein Leib sind und ihnen eine doppelte Aspektualität gegeben ist, und der Unterschied zum eigenen Leib lediglich darin besteht, dass es den privilegierten Erkenntniszugang nur zum eigenen Leib hat. Zweitens könne es annehmen, dass die anderen Objekte lediglich in der Vorstellung gegeben und damit vom eigenen Leib gänzlich verschieden sind. Dobrzański stellt fest, dass Schopenhauer die zweite Möglichkeit, den „theoretischen Egoismus“, ablehnt, ohne diesen widerlegen zu können oder gar es zu versuchen, und sich stattdessen bewusst für die analoge Sichtweise auf andere Objekte entscheidet, um überhaupt noch etwas positiv über die Welt aussagen zu können. Dobrzański fasst zusammen, dass durch diese Schritte die anderen Objekte einen zweiten, dem Subjekt nicht zugänglichen Aspekt erhalten und die vorläufige Konsequenz eine Vielzahl von Individualwillen sei.[83] Außerdem werde der Schritt der Deutung des individuellen Wollens als Teil eines größeren Wollens, von dem alle Objekte der Vorstellung „erfüllt sind“, üblicherweise als Analogieschluss bezeichnet.[84] Dobrzański kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass die Betrachtung der Welt als Wille das Ergebnis einer Spekulation sei. Interessant ist zudem seine Darstellung von Schopenhauers System, in der er die Welt zweiteilt: In die „Betrachtung als Vorstellung (Empirie)“ und in die „Betrachtung als Wille (Metaphysik)“. Erstere Betrachtung unterteilt Dobrzański wiederum in die „reale Dimension (sinnliche Welt)“ und „mentale Dimension (geistige Welt)“. Damit stellt er Schopenhauers immanente dualistische Weltbild dar, das sich in das metaphysische monistische Weltbild einfügt.[85] Diese Darstellung allein wirft die Frage auf, ob nicht die Leib-Wille-Identität problematischer ist: Wenn die Introspektion auch innerhalb der Vorstellung stattfindet, und das erkennende Subjekt vom eigenen Leib nicht das metaphysische Ansich kennt (es den Leib nicht subjektunabhängig wahrnimmt), ist auch die Stelle des Analogieschlusses hinfällig.
Gebrecht spricht vom „sogenannten“ Analogieschluss und stellt fest, dass die Mehrheitsmeinung in der Schopenhauerforschung dieses Argument „mindestens als unzureichend für die Begründung der Willensmetaphysik“[86] sieht.
Gwinner schreibt im Nebensatz, als er Schopenhauer gegen den Vorwurf, er lehre die Erkenntnis des Dings an sich, verteidigt, dass Schopenhauers Analogie als Schluss dient,[87] und scheint also eher von einem belastbaren Analogieschluss auszugehen.
Bei Hasse findet sich die Bezeichnung „Analogieschluss“ für die mittlerweile als „sogenannter Analogieschluss“ bekannte Stelle in § 19 W I noch nicht. Nach Hasse entscheidet sich Schopenhauer schlicht gegen den an sich nicht widerlegbaren Solipsismus. Dann bediene sich Schopenhauer zur Erklärung der anderen Objekte des einzigen Objekts, das dem Subjekt bekannt ist und nehme aus der Leib-Wille-Identität die Elemente Wille und Vorstellung zur Entschlüsselung der anderen Objekte.[88]
Hallich konstruiert zunächst ein zirkuläres Analogieargument und nennt das Ziel des Arguments, eine relevante Ähnlichkeit zwischen dem Leib und den übrigen Vorstellungen nachzuweisen. Diese Ähnlichkeit bestehe darin, dass Leib und die übrigen Vorstellungen Wille sind. Ist diese relevante Ähnlichkeit gegeben, so Hallich, darf von einer Analogie zwischen Leib und den anderen Objekten ausgegangen werden und damit auch davon, dass die anderen Objekte wie der Leib nicht nur Wille, sondern auch Vorstellung seien:
„In Schopenhauers Analogieargument besteht die nachzuweisende relevante Ähnlichkeit zwischen dem Leib und den übrigen Vorstellungen. Sie besteht, so soll das Argument zeigen, darin, dass sowohl der Leib als auch die übrigen Vorstellungen Wille sind. Wenn diese relevante Ähnlichkeit besteht, ist es gerechtfertigt, von einer Analogie zwischen dem Leib und den übrigen Vorstellungen auszugehen, genauer: anzunehmen, dass, ebenso wie der Leib Vorstellung und Wille ist, auch die übrigen Vorstellungen dies sind.“[89]
Demnach müsste Schopenhauer das innere Wesen anderer Objekte nachweisen, um eine Analogie herzustellen, deren vermeintlicher Zweck aber der Nachweis des Willens als „Kern aller Wesen“ [90] doch erst ist.
Hallich diskutiert darüber hinaus allerdings zwei wichtige Punkte zum sog. Analogieschluss. Erstens geht es ihm darum, was daraus folgt, dass Schopenhauer als „empirischer Realist“[91] den Solipsismus verwirft und nicht nur eine unabhängige Realität der Außenwelt leugnet,[92] sondern sie auch als „vollkommen real“[93] bezeichnet. Schopenhauer vermische hier zwei Fragen: die Frage nach der Realität der Außenwelt und die Frage danach, was die Außenwelt ist.[94] Da Schopenhauer allerdings, wie Hallich auch anführt, ein „stützendes Zusatzargument“ liefert, und darauf verweist, dass man außer Wille und Vorstellung nichts kenne, hat er beide beantwortet, obwohl daraus nicht notwendig folgt, dass die anderen Objekte auch Wille sind und dieselben Attribute haben, weil man nichts anderes kenne.[95]
Zweitens argumentiert Hallich dafür, den Analogieschluss bei allen „nicht zu bestreitenden argumentativen Defizite[n]“[96] nicht isoliert zu betrachten. Er nennt den Analogieschluss eine Analogiethese mit dem Status einer Hypothese.[97] Diese Aussage stützt Hallich zum einen darauf, dass Schopenhauer Kriterien für die Überprüfung von metaphysischen Hypothesen liefert. So soll eine metaphysische Hypothese möglichst viele Phänomene der Erfahrungswelt kohärent erklären. Wenn man das berücksichtigt, kann, so Hallich, Schopenhauer nicht den Anspruch haben, dass der sogenannte Analogieschluss allein für die Willensmetaphysik argumentiert:
„Dies verweist darauf, dass Schopenhauer nicht beabsichtigte, die Kernthese seines Hauptwerks, dass die Welt Wille ist, vollständig vom Argumentationsgang der §§ 17–21 abhängig zu machen, und sich im klaren darüber war, hiermit keine zwingenden Argumente, sondern bestenfalls Plausibilitätsargumente zugunsten dieser willensmetaphysischen Hauptthese vorgelegt zu haben. Es wäre also völlig verfehlt anzunehmen, dass die §§ 17–19 die gesamte Begründungslast für die Willensmetaphysik tragen sollen“[98]
Stattdessen wird nach Hallich also nach Setzung von Schopenhauers Hauptthese in §§ 19 ff. diese plausibler gemacht und die Erfahrungswelt erklärt – und damit entsprechend gestärkt.[99]
Jeske spricht lediglich vom sogenannten Analogieschluss.[100]
Auch für Juhos scheint der Analogieschluss kein echter zu sein, er schreibt vom Analogieschluss in Anführungszeichen, wenn er Schopenhauers Sätze zur Metaphysik als inhaltsleer und unwiderlegbar kritisiert. Er scheint allerdings davon auszugehen, dass Schopenhauer von „dumpfen Seinsgefühl“ im Subjekt zu einer allgemeinen Deutung über die gesamte Natur gelangt.[101]
Koßler meint, dass es für den Analogieschluss nur eine negative Begründung geben kann, da die Leugnung eines zugrundeliegenden Dinges an sich dem theoretischen Egoismus gleichkäme. Er sieht Schopenhauers Annahme des Dinges an sich bei anderen Objekten also als eine Alternative dazu, die die zum eigenen Leib analoge Bewertung von anderen Objekten notwendig zur Folge hat, da, wie Schopenhauer schreibt, außer Wille und Vorstellung nichts bekannt oder denkbar sei.[102] Die Folge des Analogieschlusses sei streng genommen, dass so wie wir ein subjektives Ansichsein haben, das Schopenhauer „Wille“ nennt, jedes Ding ein Ansichsein, „das es, verfügte es über ein Bewußtsein, ebenso subjektiv erfahren würde.“[103] Dabei stellt Koßler allerdings fest, dass Schopenhauer dafür den sog. Analogieschluss gar nicht bräuchte, da er dessen Ablehnung zuvor bereits als „ernstliche Ueberzeugung hingegen […] allein im Tollhause“[104] verortete und für diese Ansicht keine argumentative Auseinandersetzung, sondern eine Kur für nötig befand. Koßler bewertet dieses Vorgehen Schopenhauers nicht als einen Analogieschluss, schon allein deswegen nicht, weil die Sphären Willensakt und Leibesbewegung bzw. Wille und Leib nicht kausal verknüpft sind.[105]
Malter schreibt erstens, dass Schopenhauer den Solipsismus nicht ernst genug nehme und stellt zweitens fest, dass ein förmlicher Beweis für die Welt-Wille-Identität nicht möglich ist.[106] Auch vollziehe Schopenhauer keinen förmlichen Analogieschluss. Für ihn steht das Ergebnis schon im Vorhinein fest und neben der Demonstration an empirischen Indizien, versuche Schopenhauer Erscheinungen nach der Analogie zum eigenen Leib zu bewerten. Mittels „Analogieverfahren“ werden die Elemente der Realität des Leibes zu den Elementen für alles Seiende.[107]
Novembre bezeichnet den Analogieschluss als „entscheidend“ und drückt aus, dass nur mittels dieser Analogie der Wille zum An-sich aller Objekte werden könne.[108]
Nach Schubbe muss Schopenhauer die Welt per Analogie erschließen, da er die Welt als etwas dem Menschen Fremdes versteht.[109] Er meint allerdings, die Analogie würde überhöht und aus der „Ähnlichkeit meinerselbst mit der Welt wird eine indifferente Einheit der Dinge“[110].
Für Spierling ist es kühne Spekulation, dass Schopenhauer mit einem Analogieschluss die Erfahrung des eigenen Leibes als Willen von innen und als Vorstellung von außen auf die gesamte Natur überträgt und somit die Leib-Wille-Identität als „Modell für die Welt“ gebraucht.[111]
Nach Strohm beruht Schopenhauers Metaphysik auf zwei Analogieschlüssen. Als ersten Analogieschluss bezeichnet Strohm den Schluss „vom eigenen Inneren aufs Innere aller anderen Wesen“[112] und als zweiten die Gleichsetzung von Willen und Ding an sich. Sowohl für den sog. Analogieschluss in § 19 WI, den er eine „Verallgemeinerung“ nennt, als auch für die Wille-Ding an sich-Gleichsetzung schreibt Strohm, dass Schopenhauer dafür strenggenommen keine Argumente hat und diese Schlüsse illegitim seien. Schopenhauer hätte nicht den Anspruch auf Wahrheit im strengen Sinne, sondern wolle ein „rein hypothetisches, heuristisch funktionales Prinzip“ [113] formulieren.
Welsen schreibt, dass Schopenhauer durch einen Analogieschluss versuche, das Ding an sich mit dem Willen gleichzusetzen. Dafür nimmt Schopenhauer nach Welsen an, dass der Leib und andere Dinge der Vorstellung eine Anzahl von Eigenschaften teilen und daher eine zusätzliche Eigenschaft („Erscheinung des Willens als Ding an sich“[114]) teilen müssen. Welsen kritisiert dies: Analogieschlüsse eigneten sich generell nicht, um gehaltserweiternde Aussagen zu begründen. Bestenfalls sei dies als eine Hypothese möglich. Außerdem drängt sich ihm der Verdacht auf, Schopenhauer deute die Natur anthropomorph. Letztere Kritik weicht er dann auf, in dem er darauf verweist, dass Schopenhauer den Begriff des Willens im Menschen in einem stärkeren Sinne versteht als in der restlichen Natur, in der er Abstufungen beschreibt.[115]
Weimer bezeichnet den „viel diskutierten Analogieschluss“ als „logisch sehr fragwürdig“, weil diese Analogie auf nur einem belegbaren Fall beruht.[116]
Zimmermann sieht den Analogieschluss als eine Brücke zwischen Leib-Wille-Identität und Welt-Wille-Identität, die nur dadurch für Schopenhauer möglich ist, da er sich gegen den sog. theoretischen Egoismus entscheidet. Schopenhauer musste anderen Objekten zubilligen, nicht nur Vorstellung, sondern auch Wille zu sein. Dass er nichts anderes an Dasein oder Realität als Wille und Vorstellung kenne als Wille und Vorstellung, nennt Zimmermann einen Versuch der Rechtfertigung.[117]
Möglichkeit eines Analogieschlusses
Struktur und Bewertung
Nach den aufgeführten Problemen der als Analogieschluss bezeichneten Stelle in Schopenhauers Werk soll es darum gehen, ob grundsätzlich ein Analogieschluss in Schopenhauers Argumentation seinem Projekt dienen würde.
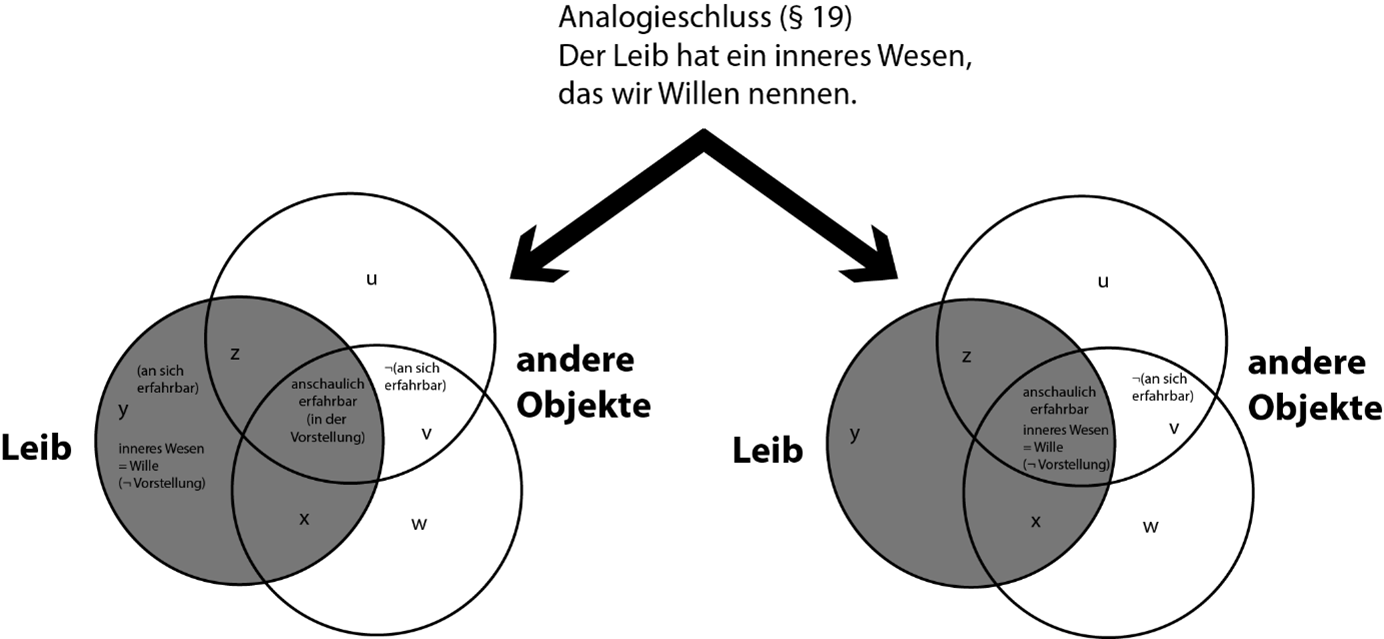
|
Abbildung 6: "Wille" als Eigenschaft des Leibes und auch anderer Objekte? |
Wie müsste ein Analogieschluss aussehen, wenn er als argumentativer Weg von der Leib-Wille-Identität zur Welt-Wille-Identität fungieren sollte? Oder anders gesagt: Ist Schopenhauers sogenannter Analogieschluss überhaupt als Analogieschluss denkbar?
Die Struktur ist folgende (Abbildung 6). In der Vorstellung sind viele Objekte anschaulich erfahrbar. Diese in der Art gegebenen Objekte unterscheiden sich äußerlich teilweise sehr und es gibt vielfältige und gut begründbare Möglichkeiten, sie zu klassifizieren. Eine davon ist, wie nachfolgend dargestellt, auch bei Schopenhauer zu finden. Dieser Ansatz eines Analogieschlusses will allerdings weiter gehen und hat nicht eine Aussage über einzelne kleine Klassen von Objekten zum Ziel, sondern eine Aussage über alle Objekte. Von einem bestimmten Objekt, dem Leib, von dem eine bestimmte Eigenschaft bekannt ist, soll auf alle anderen Objekte geschlossen werden. Von diesen ist nämlich diese eine Eigenschaft des Leibes nicht bekannt: Haben sie ein „an sich“ wie der Leib eines hat? Der Leib ist uns im Gegensatz zu den anderen Objekten nicht nur anschaulich gegeben. Ist die Eigenschaft, ein inneres Wesen zu haben, eine, die nur dem Leib zukommt, oder teilen sich alle anschaulich gegebenen Objekte diese Eigenschaft?
Die Struktur entspricht somit bei einer oberflächlichen Betrachtung der eines klassischen Analogieschlusses. Gegeben sind der Leib und andere Objekte. Der Leib hat eine Eigenschaft (ein „an sich“ zu besitzen). Fraglich ist nun, ob die anderen Objekte diese Eigenschaft teilen. Der Leib und die anderen Objekte sind einander dahingehend ähnlich, dass sie eine andere Eigenschaft teilen: Sie sind anschaulich gegeben. Also gehen wir davon aus, dass den anderen Objekten auch die eine besondere Eigenschaft des Leibes zukommt.
Werfen wir einen Blick auf die formalen Möglichkeiten zur Bewertung einer Analogie, um zu sehen, ob ein Analogieschluss in § 19 bei Schopenhauer überzeugend wäre. Zunächst muss geprüft werden, ob der Analogieschluss mit seinen ausgewählten Objekten und Eigenschaften überzeugend ist und dann sind die Möglichkeiten der Widerlegung zu prüfen.
Zur Erinnerung: Eine hohe Qualität hat der Analogieschluss durch eine größere Anzahl von verschiedenartigen Objekten die mit einem weiteren Objekt bis auf eine (fragliche) Eigenschaft viele relevante teilen.
Welche (relevanten) Eigenschaften verbinden den Leib und die anderen Objekte? In Frage kommt lediglich eine einzige: Sie sind anschaulich in der Vorstellung gegeben. Da das aber ein notwendiges Kriterium für das Objektsein ist, ist diese Eigenschaft allein kaum geeignet für eine Analogie. Es ist nun mal nichts anderes denkbar. Wie Goethe schreibt, spricht es gegen eine Analogie, wenn alles zusammenfällt. Dann ist sie zu weit angelegt:
„Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden, daher erscheint uns das Dasein immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche. In beiden Fällen stagniert die Betrachtung, einmal als überlebendig, das andere Mal als getötet.“[118]
Natürlich wäre dieser Analogieschluss vom Ergebnis ausgehend in Schopenhauers Sinn, da er aussagen möchte, dass in allen Erscheinungen dasselbe innere Wesen ist, in dem Sinn also alles eins ist.
„Denn, wenn auch wahrscheinlich die Herren alle mit mir der Meinung sind, daß in allen Erscheinungen dieser Welt das innere Wesen, das Erscheinende, das Ansich der Dinge, überall das selbe ist und der Unterschied der Erscheinungen eigentlich bloß den Grad der Sichtbarwerdung desselben betrifft; so hebt diese innere Identität des Wesens der Dinge dennoch nicht den Unterschied auf, den von jeher die Worte lebend und leblos bezeichnet haben, welchem gemäß nur das Organische lebend, das Unorganische leblos genannt wird.“[119]
Aber formal ist ein solcher Analogieschluss nicht ausreichend. Es gibt zu wenige Gemeinsamkeiten zwischen den Objekten. Die Analogie ist zu weit gefasst, um überzeugen zu können.
Zur Widerlegung gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens könnte man in Objekt B eine Eigenschaft d finden, die A nicht hat (Disanalogie). Damit wäre es weniger plausibel, dass in B eine Eigenschaft c ist, von der man weiß, dass sie in A ist. Es gilt dabei die Voraussetzung, dass A und B Gemeinsamkeiten (a, b) haben, und dass die jeweilige Relevanz von Eigenschaften gegeben ist. Die zweite Möglichkeit ist die Gegenanalogie, bei der ein drittes Objekt C die gleichen Gemeinsamkeiten (a, b) wie A und B aufweist, aber nicht c, wie A sie hat, sondern ¬c.
Wie könnte eine Disanalogie aussehen? Wie in Abbildung 6 dargestellt, haben der Leib und andere Objekte gemeinsam, dass sie in der Vorstellung und dementsprechend anschaulich erfahrbar sind. Der Leib des erkennenden Subjekts hat die Eigenschaft, die per Analogieschluss auf die anderen Objekte übertragen werden soll, nämlich, dass das innere Wesen Wille ist. Der Leib hat zudem die Eigenschaft, dass er dem Subjekt innerlich erfahrbar ist, was anderen Objekten nicht zukommt. Entscheidend für die Disanalogie ist, dass andere Objekte, von denen es ganz unterschiedliche Typen gibt, auch Eigenschaften haben, die der Leib nicht hat. Tiere sind nicht vernunftbegabt, Pflanzen haben feste Zellwände und Stahl ist anorganisch. Sind dies nun relevante Eigenschaften für eine Disanalogie? Es sind alles lediglich Variationen der einen gemeinsamen Eigenschaft, die sie alle verbindet. Es sind materielle Eigenschaften. Dies spielt sich notwendigerweise alles in der Anschauung ab. Die Disanalogien führen auf ein und denselben Punkt und sind allesamt auf die Dimension Erfahrung beschränkt, aber widersprechen der gemeinsamen Eigenschaft der Objekte (inkl. Leib) nicht. Dadurch sprechen sie der Analogie ihren Wert nicht ab.
Auch Gegenanalogien führen hier nicht weiter. Dazu müsste es nämlich Objekte in der Vorstellung geben, von denen wir sicher sagen können, dass sie nicht haben, was wir an uns erkennen: ein Inneres, welches wir an uns Willen nennen. Dafür fehlt uns allerdings der Zugang.
Wenn der Blick auf die „anderen Objekte“ etwas geschärft wird, erscheint die Stelle des Analogieschlusses wie das Problem des Fremdpsychischen, wo ein Analogieschluss besser zu vertreten ist. Dazu muss zunächst innerhalb von Schopenhauers Philosophie auf die Klassen von Objekten geschaut werden.
Vier Arten von Objekten
In seiner Probevorlesung referierte Schopenhauer 1820 über die vier verschiedenen Arten der Ursachen, nach denen er auch alle anschaulichen Objekte klassifiziert.[120] Alle Objekte, ebenso der Leib, sind in eine von vier Klassen klassiert. Diese Klassen bauen aufeinander auf und können hierarchisch verstanden werden. Die oberste Klasse wird durch die alle Arten von Ursachen bestimmt, während jede Klasse darunter durch eine Art von Ursachen weniger bestimmt wird.
Die erste Klasse von Körpern ist die der unorganischen oder leblosen Körper.[121] Körper dieser Klasse werden ausschließlich durch die sogenannten Ursachen im engeren Sinne bestimmt. Diese Ursachen zeichnen sich durch eine genaue Gleichmäßigkeit zwischen Ursache und Wirkung aus und sind Gegenstand der Mechanik, Physik und Chemie. Als Beispiele nennt Schopenhauer das Verdichten und Erhitzen.[122]
Die zweite Klasse von Körpern sind Pflanzen. Diese sind dadurch bestimmt, dass sie ausschließlich durch die zweite Art von Ursachen, nämlich den Reizen, bestimmt wird, soweit es Veränderungen betrifft, die ihrer Natur nach angemessen sind.[123] Daraus ist zu schließen, dass, wie es auch realitätsnah erscheint, auch Pflanzen (wie auch alle folgenden Klassen) von niederen Ursachen betroffen sind, wie Schopenhauer auch hier bei der Beschreibung der Charakteristika von Reizen (keine Gleichmäßigkeit von Ursache und Wirkung) verdeutlicht:
„Pflanzen können bekanntlich durch Wärme oder der Erde beigemischte[n] Kalk zu einem außerordentlich schnellen Wachstum getrieben werden, indem jene Ursachen als Reize ihrer Lebenskraft wirken: wird jedoch hiebei der Grad des Reizes um ein weniges überschritten, so wird der Erfolg statt des erhöhten und beschleunigten Lebens, der Tod der Pflanze seyn. Ferner können wir durch Wein oder Opium unsre Geisteskräfte anspannen und beträchtlich erhöhen: wird aber das Maas des Reizes überschritten; so wird der Erfolg grade der entgegengesetzte seyn.“[124]
Das Zusammenspiel zwischen dem Reiz als Ursache und der Wirkung ist dabei also nicht gleichmäßig, wie bei Schopenhauers erster Art von Ursache, dennoch regelmäßig, da „die Wirkung ein unverkennbares Verhältniß zur Dauer und Intensität des Reizes hat, wenn gleich dieses Verhältniß nicht bei allen Graden des Reizes dasselbe bleibt […]“[125]
Die dritte Klasse von Körpern sind Tiere, die neben Reizen (und Ursachen im engeren Sinne) auch von Motiven betroffen sind.[126] Diese Motive sind beim Tier rein anschaulich.[127] (Nicht-menschliche) Tiere sind nach Schopenhauer immer dadurch motiviert, was sie in der Gegenwart empfinden.[128] Die Empfindungen resultieren bei Tieren teils auch aus äußeren sinnlichen Wahrnehmungen mittels Reizen, die mit ihrem Verstand, den Schopenhauer als wesentliches Merkmal von Tieren ansieht,[129] zu anschaulichen Motiven werden. Die Auswirkung eines Motivs hängt dabei für Schopenhauer nicht von der Dauer der Wirkung auf das Tier ab (im Unterschied zu reinen Reizen).[130]
Der Unterschied zwischen der vierten Klasse von Objekten, den Menschen, von denen der Leib des Subjekts im Analogieschluss eben auch einer ist, und nichtmenschlichen Tieren liegt für Schopenhauer in der Vernunft und der Empfänglichkeit für abstrakte Motive. Während der Mensch wie auch ein nicht vernunftbegabtes Tier beispielsweise in einer Müllpresse komprimiert werden, vom üblen Geruch einen Brechreiz erleiden und vom Anblick eines Todessterns zur Flucht motiviert werden könnte, kann eben nur der Mensch auf abstrakte Motive wie beispielsweise Lenkungssteuern (wirtschaftliche Anreize) reagieren. „Mit Einem Wort: das Thier empfindet und schaut an; der Mensch denkt überdies und weiß.“[131]
Während das Tier auf anschauliche Motive wie etwa Futter reagiert, kann ein Mensch auch von Begriffen (= „gedachte nicht angeschaute Vorstellungen“[132]) motiviert sein, beispielsweise Gerechtigkeit.
Die Objekte in der für das Subjekt vom Verstand unbewusst geschaffenen Anschauung[133] gliedert Schopenhauer also in vier Klassen (Objektivationsstufen) nach ihrer Empfänglichkeit für vier Arten von Ursachen: Unbelebte Objekte, Pflanzen, Tiere und Menschen. Rein äußerlich unterscheiden sich diese Ursachen und Objektivationen, aber dem Wesen nach sind sie identisch:
„Aber ein argumentum ad oculos erhielt ich erst, als ich eines Abends mit ihm im Englischen Hof beim Schoppen Wein saß und er beim Ausstrecken der Hand nach dem Glase bemerkte, dieser Willensact sei nicht wesentlich verschieden von irgend einem mechanisch durch Stoß oder Zug bewirkten Naturact, d.h. Äußerung einer blinden Naturkraft. Nur die veranlassenden Ursachen seien in beiden Fällen verschieden. Dort ein Motiv – das angeschaute Weinglas; hier eine mechanische Ursache. Aber beide Acte erfolgten mit gleich strenger Nothwendigkeit.“[134]
Exkurs: Fremdpsychisches
Ein Analogieschluss ausgehend von der Leib-Wille-Identität zur Identität mit anderen Objekten derselben oder einer näheren Klasse wäre stärker. Man kann mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Leib und einigen anderen Objekten benennen. Beispielsweise könnte man zwischen dem Leib und anderen menschlichen Objekten eine Analogie aufbauen, wie sie beim Problem des Fremdpsychischen bekannt ist: So meint Bertrand Russel, dass mit von anderen Menschen äußerlich Wahrnehmbaren analog zu dem von außen Wahrnehmbaren von uns auf Fremdpsychisches geschlossen werden kann:
„It is clear that we must appeal to something that may be vaguely called "analogy." The behavior of other people is in many ways analogous to our own, and we suppose that it must have analogous causes. What people say is what we should say if we had certain thoughts, and so we infer that they probably have these thoughts. They give us information which we can sometimes subsequently verify. They behave in ways in which we behave when we are pleased (or displeased) in circumstances in which we should be pleased (or displeased). We may talk over with a friend some incident which we have both experienced, and find that his reminiscences dovetail with our own; this is particularly convincing when he remembers something that we have forgotten but that he recalls to our thoughts. Or again: you set your boy a problem in arithmetic, and with luck he gets the right answer; this persuades you that he is capable of arithmetical reasoning. There are, in short, very many ways in which my responses to stimuli differ from those of "dead" matter, and in all these ways other people resemble me. As it is clear to me that the causal laws governing my behavior have to do with "thoughts," it is natural to infer that the same is true of the analogous behavior of my friends.“[135]
Das eigene geistige Innenleben, unsere Gedanken und Gefühle, sind äußerlich nicht direkt wahrnehmbar. Beim Fremdpsychischen ist das auch nicht der Fall. Beobachtet man andere Menschen, die sich als Blackbox darstellen, und man sieht den Input (Umstände, Einflüsse) aus verschiedenen Situationen und vergleicht deren Output (Verhalten, verbale Äußerungen) damit, was wir bei demselben Input getan hätten (Output), oder wie wir über diese Situation denken, so scheint die jeweils große Ähnlichkeit zwischen eigenem und fremdem Input und Output nahezulegen, dass andere Menschen wie wir denken und fühlen.
„From subjective observation I know that A, which is a thought or feeling, causes B, which is a bodily act, e.g., a statement. I know also that, whenever B is an act of my own body, A is its cause. I now observe an act of the kind B in a body not my own, and I am having no thought or feeling of the kind A. But I still believe, on the basis of self-observation, that only A can cause B; I therefore infer that there was an A which caused B, though it was not an A that I could observe. On this ground I infer that other people’s bodies are associated with minds, which resemble mine in proportion as their bodily behavior resembles my own.“[136]
Dieser Analogieschluss basiert darauf, dass man nicht nur eine zeitliche Abfolge, sondern eine kausale Verbindung zwischen Geist und Körper kennt, beispielsweise eine durch meinen Gedanken erfolgende Bewegung durch meinen Körper. Beobachte ich eine Bewegung eines anderen Körpers und mir fehlt ein eigener sie auslösender Gedanke, schließe ich darauf, dass der anderen Körper einen entsprechenden Gedanken hat und demzufolge schließe ich auf Fremdpsychisches.
Ein Analogieschluss, wie Russell ihn hier durchführt, ist für Schopenhauer nicht denkbar. Willensakt und Körperbewegung sind bei ihm nicht kausal verknüpft:
„Jeder wahre Akt seines Willens ist sofort und unausbleiblich auch eine Bewegung seines Leibes: er kann den Akt nicht wirklich wollen, ohne zugleich wahrzunehmen, daß er als Bewegung des Leibes erscheint. Der Willensakt und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene Zustände, die das Band der Kausalität verknüpft, stehen nicht im Verhältniß der Ursache und Wirkung; sondern sie sind Eines und das Selbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben: einmal ganz unmittelbar und einmal in der Anschauung für den Verstand. Die Aktion des Leibes ist nichts Anderes, als der objektivirte, d.h. in die Anschauung getretene Akt des Willens.“[137]
Dieser Exkurs liefert allerdings eine Schwachstelle, die Russells Analogieschluss und auch ein möglicher in § 19 gemein haben: Wie Malcolm am Analogieschluss von John Stuart Mill, der ähnlich wie Russell argumentiert, kritisiert, ist ein solcher induktiver Schluss sehr schwach, da er von einer einzigen Instanz schließt[138] und an Weimers Kritik an Schopenhauers Schluss erinnert.[139] Nichts anderes als das Schließen von dem einen Objekt, nämlich dem Leib, auf andere Objekte, bliebe Schopenhauer übrig, wäre ein Analogieschluss seine argumentative Verknüpfung zwischen Leib-Wille-Identität und Welt-Wille-Identität.
Gemeinsamkeiten zwischen Objekten
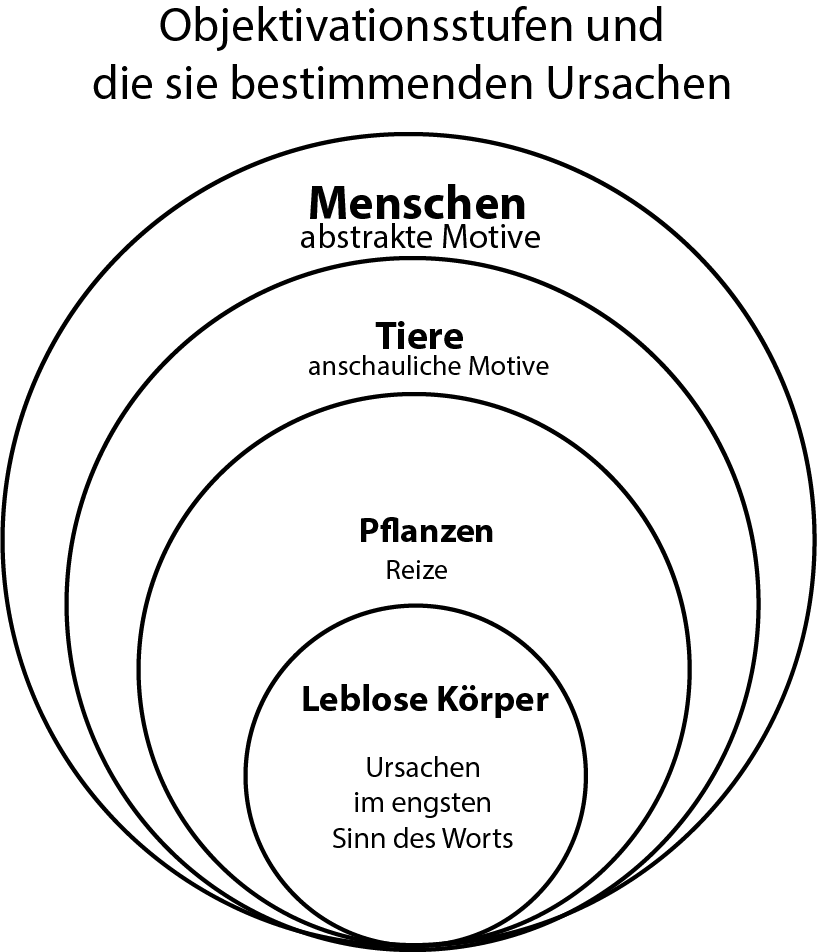
|
Abbildung 7: Objektivationsstufen und die sie bestimmenden Ursachen |
Jenseits der Dis- und Gegenanalogien und der o.g. Kritik, die auch Russells und Mills Analogieschluss betrifft, könnte man einen Schwachpunkt daran sehen, dass eben nur eine Gemeinsamkeit zwischen Leib und anderen Objekten hergestellt wird. Betrachtet man nun die dargestellten Objektivationsstufen mit den höchsten sie bestimmenden Ursachenarten in Abbildung 7, so stellt man fest, dass ein weiter Analogieschluss vom einzelnen Leib auf alle diese Objektklassen[140] darunter leidet, dass die Anzahl der Gemeinsamkeiten gering ist. Schopenhauers Ausgangspunkt in § 18 beschränkt sich nicht nur darauf, dass es Objekte gibt, die auf Ursachen reagieren (Ursachen, Reize, Motive), sondern er baut die Leib-Wille-Identität auf und versucht dies gerade mit Blick auf den Unterschied zwischen dem eigenen Leib und den anderen Objekten:
„Dieser Leib ist dem rein erkennenden Subjekt als solchem eine Vorstellung wie jede andere, ein Objekt unter Objekten: die Bewegungen, die Aktionen desselben sind ihm in soweit nicht anders, als wie die Veränderungen aller anderen anschaulichen Objekte bekannt, und wären ihm ebenso fremd und unverständlich, wenn die Bedeutung derselben ihm nicht etwan auf eine ganz andere Art enträthselt wäre. Sonst sähe er sein Handeln auf dargebotene Motive mit der Konstanz eines Naturgesetzes erfolgen, eben wie die Veränderungen anderer Objekte auf Ursachen, Reize, Motive. Er würde aber den Einfluß der Motive nicht näher verstehen, als die Verbindung jeder andern ihm erscheinenden Wirkung mit ihrer Ursache. Er würde dann das innere, ihm unverständliche Wesen jener Aeußerungen und Handlungen seines Leibes, eben auch eine Kraft, eine Qualität, oder einen Charakter, nach Belieben, nennen, aber weiter keine Einsicht darin haben. Diesem allen nun aber ist nicht so: vielmehr ist dem als Individuum erscheinenden Subjekt des Erkennens das Wort des Räthsels gegeben: und dieses Wort heißt Wille.“[141]
Der Leib reagiert für das Subjekt nicht einfach wie andere Objekte auf Ursachen (im weiteren Sinne). Er hat eine besondere Beziehung zum Subjekt:
„Jeder wahre, ächte, unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender Akt des Leibes: und diesem entsprechend ist andererseits jede Einwirkung auf den Leib sofort und unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen: sie heißt als solche Schmerz, wenn sie dem Willen zuwider; Wohlbehagen, Wollust, wenn sie ihm gemäß ist. Die Gradationen beider sind sehr verschieden. Man hat aber gänzlich Unrecht, wenn man Schmerz und Wollust Vorstellungen nennt: das sind sie keineswegs, sondern unmittelbare Affektionen des Willens, in seiner Erscheinung, dem Leibe: ein erzwungenes augenblickliches Wollen oder Nichtwollen des Eindrucks, den dieser erleidet.“[142]
Schopenhauer nimmt schmerzvolle Einwirkungen auf den Leib, die bei ihm auch auf Nichtwollen treffen, als Beleg für die Leib-Wille-Identität. Diese Schmerzen oder wenigstens die Reaktion darauf ist bei Menschen beobachtbar und auch bei Tieren:
„Wer die Behauptung, daß, in der Welt, der Genuß den Schmerz überwiegt, oder wenigstens sie einander die Waage halten, in der Kürze prüfen will, vergleiche die Empfindung des Thieres, welches ein anderes frißt, mit der dieses andern.“[143]
Auf Objekte der unteren Objektivationsstufen (Pflanze und Anorganisches) trifft dies nicht zu. Würde Schopenhauer darauf aufbauen und analog zu Mill und Russell einen Analogieschluss nutzen, könnte er sich auf mehr Ähnlichkeiten zwischen Leib und anderen Objekten stützen – und damit den Analogieschluss stärken. Die von Malcolm genannte Schwäche dieser Analogieschlüsse bliebe, aber ein Analogieschluss vom eigenen Leib auf alle Menschen und Tiere ist aufgrund der Gemeinsamkeiten stärker (formal überzeugender) als ein Analogieschluss vom Leib auf alle Objekte (inklusive Pflanzen und Anorganisches).
Das Problem bei diesem hypothetischen Analogieschluss ist, dass er Schopenhauer nichts nützen würde. Er möchte nicht für Fremdpsychisches möglichst vieler Objektklassen argumentieren, sondern für seine metaphysische Grundlage aller Objekte in der Vorstellung. Das für einen Analogieschluss formal richtige Ansinnen, viele gemeinsame Eigenschaften zu suchen, führt nicht weiter, weil dann notwendigerweise die Zahl der Objekte, auf die der Schluss angewandt werden kann, sinkt. Auch hätte ein Analogieschluss bei Schopenhauer denselben Schwachpunkt, den klassische Analogieschlüsse wie bei Mill und Russell haben: Man schließt von bloß einem einzigen Objekt auf viele.
Schopenhauers Analogieschluss in § 29 W I?
Während der sogenannte Analogieschluss in § 19 W I formal nicht als solcher zu sehen ist und auch in der Literatur überwiegend nicht als ein solcher betrachtet wird, scheint es in § 29 so, als gebe Schopenhauer uns als Selbstversuch zur Bestätigung seiner Philosophie einen Analogieschluss an die Hand. Jedenfalls wird diese Stelle als eine Ergänzung zum Analogieschluss betrachtet.[144]
„Jeder findet sich selbst als diesen Willen, in welchem das innere Wesen der Welt besteht, so wie er sich auch als das erkennende Subjekt findet, dessen Vorstellung die ganze Welt ist, welche insofern nur in Bezug auf sein Bewußtseyn, als ihren nothwendigen Träger, ein Daseyn hat. Jeder ist also in diesem doppelten Betracht die ganze Welt selbst, der Mikrokosmos, findet beide Seiten derselben ganz und vollständig in sich selbst. Und was er so als sein eigenes Wesen erkennt, dasselbe erschöpft auch das Wesen der ganzen Welt, des Makrokosmos: auch sie also ist, wie er selbst, durch und durch Wille, und durch und durch Vorstellung, und nichts bleibt weiter übrig.“[145]
Jeder kann sich als Willen (wollendes Subjekt) wahrnehmen und hat damit Zugang zum „inneren Wesen der Welt“ und „findet sich“ als erkennendes Subjekt bzw. dessen Vorstellung. Man hat nach Schopenhauer Zugang zum inneren Wesen der Welt, in dem man sich also als wollendes Subjekt wahrnimmt, und dazu hat, wie man diesen Abschnitt lesen muss, man die Perspektive auf den eigenen Leib und erkennt, dass man eine doppelte Perspektive hat. Als erkennendes Subjekt erkennt man nur den Leib in der Vorstellung als Objekt, nicht aber sich als erkennendes Objekt, wie er schreibt: „Dasjenige was Alles erkennt und von keinem erkannt wird, ist das Subjekt.“[146] Das Subjekt findet sich immer als ein wollendes Subjekt.[147]
Mit dieser Leib-Wille-Identität („was er so als sein eigenes Wesen erkennt“) kann jeder erkennen, woraus die Welt besteht (Wille und Vorstellung). Aber es handelt sich nicht um einen Analogieschluss. Schopenhauer beschreibt lediglich das Ergebnis von § 19.
Analogieschluss in der Vorlesung
Der Analogieschluss in Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung findet sich in der ersten[148] genau wie in der dritten von ihm veröffentlichten Auflage.[149] Im zweiten Teil der Vorlesung über die gesammte Philosophie findet sich derselbe Schluss in Cap. 4:
„Diese Erkenntniß werden wir nun bald noch fester begründen und deut[licher] entwickeln; danach aber sie gebrauchen als einen Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur, indem wir auch alle ande[rn] Objekte, die nicht unser eigener Leib sind, folglich nicht wie dieser auf doppelte Weise unserm Bewußtsein offen liegen, sondern nur von einer Seite als bloße Vorstellungen ihm gegeben sind, eben nun nach Analogie jenes Leibes beurtheilen, und annehmen, daß, wie sie einerseits ganz wie der Leib Vorstellung und insofern mit ihm gleichartig sind, auch andrerseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstellungen des Subjekts ganz absondert und bei Seite setzt, das dann noch übrig Bleibende seinem innern Wesen nach, dasselbe seyn muß, als was wir in uns den Willen nennen.“[150]
In der Vorlesung stellt Schopenhauer die Zuhörer wie im Hauptwerk vor die Wahl des Solipsismus, nachdem er für die Leib-Wille-Identität argumentiert. Hier bestätigt er, dass der Solipsismus nicht hilfreich für Erkenntnisse ist, und er daher für den weiteren argumentativen Verlauf annehmen muss, die anderen Objekte haben auch ein inneres Wesen. Dass dieses anzunehmen nicht notwendigerweise heißt, dasselbe innere Wesen anzunehmen, beschäftigt Schopenhauer hier nicht. In W I schreibt er noch, dass er nichts anderes kenne als Wille und Vorstellung. Das Ansich, das er durch Introspektion als inneres Wesen bei sich kennt, nimmt er in der Vorlesung ohne diesen weiteren Schritt als Wesen aller Objekte an. Mehr noch als im Hauptwerk erscheint dies eine Setzung. Schließlich geht er davon aus, dass man das eigene innere Wesen in anderen Objekten erkennen kann:
„Diese Erkenntniß, daß der Wille und der Leib eigentlich Eins, daß was an sich Wille ist, als Erscheinung sich darstellt als belebter und zweckmäßig organisirter Leib, müssen wir fest halten: denn sie allein giebt uns den Schlüssel zum Wesen der gesammten Natur. Wir müssen sie nämlich übertragen auch auf alle jene Erscheinungen die uns nicht wie unsre eigene zwiefach gegeben und bekannt sind, nämlich in unmittelbarer Erkenntniß neben der mittelbaren; sondern die uns bloß einmal, bloß einseitig gegeben sind, nämlich bloß als Vorstellung. – Jeder nämlich (der nur nicht durch den theoretischen Egoismus sich selbst von aller Erkenntniß abschließt) wird nun zuvörderst die Erscheinungen welche, als Vorstellungen, seiner eig[enen] ganz gleich sind, auch ihrem inne[rn] Wesen nach beurtheilen als seiner eigenen gleich: also er wird nicht nur das Wesen seines eig[nen] Leibes, sondern auch das jedes menschlichen Leibes, erkennen als Willen, als jenes ihm so unmittelbar und genau bekannte. Sodann wird er zunächst dies übertragen auf die Thiere. – Die fortgesetzte Reflexion wird ihn dahin leiten, auch die Kraft welche in der Pflanze treibt und vegetirt anzusehn als ihrem inner[n] Wesen nach identisch mit dem was das Wesen seines eig[nen] vegetirenden Leibes, wie seiner Handlungen, ist, – Wille. Dasselbe innere Wesen wird er wiedererkennen auch in der Kraft durch welche der Krystall anschießt; in der welche den Magnet so beharrlich stets gegen den Nord-Pol wendet; – in der, deren Schlag ihm aus der Berührung heterogener Metalle entgegenfährt (G[alvanische] E[lektricität]); – in der Kraft welche erscheint in den Wahlverwandschaften der Stoffe als Fliehen und Suchen, Trennen und Vereinen, – ja zuletzt sogar in der Schwere, die in aller Materie so gewaltig strebt, den Stein zur Erde und die Erde zur Sonne zieht. Wir werden also alle diese Kräfte ansehn als nur in der Erscheinung verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als dasselbe, als jenes uns so unmittelbar bekannte, vertrauter und genauer bekannte als alles andre, was da, wo es sich am vollkommensten manifestirt, Wille heißt.“[151]
Da dies eine Vorlesungsschrift ist, muss man allerdings von mündlichen Ausführungen ausgehen.
Zwischenfazit
Es handelt sich bei Schopenhauers „Analogieschluss“ in § 19 W I nicht um einen Analogieschluss. Auch in der Literatur wird überwiegend die These vertreten, es handele sich um eine bedeutende Stelle in Schopenhauers Werk, aber nicht um einen Analogieschluss. Außerdem ist auch kein guter Analogieschluss an der Stelle denkbar oder Schopenhauers Ziel dienlich.
In der Schopenhauer-Forschung findet man unter den längeren Auseinandersetzungen mit dem Analogieschluss überwiegend die Feststellung, dass es sich erstens der Form nach nicht um einen Analogieschluss handelt und zweitens das Argument insgesamt, für sich genommen, wenig überzeugend ist. Auch sprechen viele Autoren vom „sogenannten Analogieschluss“, einer „Analogiemethode“, einer „Analogiethese“ oder Ähnlichem. Zudem wird in der Literatur infrage gestellt, ob Schopenhauer den sog. Analogieschluss überhaupt braucht, bzw. ob er eine ernstliche Funktion erfüllt.
Der sogenannte Analogieschluss ist also formal kein Analogieschluss, weil Schopenhauer explizit schreibt, dass er die anderen Objekte der Vorstellung bloß nach der Analogie des Leibes beurteilt und dann die Annahme trifft, sie seien so wie der eigene Leib. Dann könnte man die darauffolgende Disjunktion, er habe bloß Wille und Vorstellung als Bausteine der Realität, zwar als einen Schluss auf die beste Erklärung verstehen, aber Schopenhauer kennt bereits sein Ziel und es geht ihm womöglich an dieser Stelle darum, eine Lücke zwischen seinem ihm bereits bekannten Ziel (Welt-Wille-Identität) und dem Stand seiner argumentativen Ausführungen „zu füllen“. Da er ohne Argument das Infragestellen der Außenwelt bzw. des Fremdpsychischen mit dem Verweis darauf, es sei praktisch nie eine ernsthafte Überzeugung und führe auch nicht weiter, ablehnt, kommt Schopenhauer ohne Verweis auf eine Analogie aus und kann direkt dazu übergehen, die Bausteine der Realität auf die übrigen Objekte der Vorstellung anwenden. Da wirken in der Literatur vertretene Aussagen, er nehme den Solipsismus nicht ernst, gerechtfertigt. Schopenhauer setzt sich damit nicht ernsthaft auseinander, sondern liefert zwei Argumente, die an der Sache vorbeigehen: Der „theoretische Egoismus“ werde nie ernstlich vertreten und führe zu keiner Erkenntnis (und ist damit keine sinnvolle Annahme). Der Wahrheitswert von Aussagen hängt weder davon ab, ob jemand für sie ernsthaft argumentiert, noch davon, ob eine Aussage Gefallen findet. Allerdings ist der zweite Punkt, ob die Annahme eine weitere Erkenntnis ermöglicht, ein Anhaltspunkt für den Gedankenpfad, den Schopenhauer dem Leser bereitet. Er folgt, wie auch in der Literatur dargelegt, nicht Schopenhauers Überlegungen unmittelbar, sondern wird zu einem Ziel geführt, das Schopenhauer fest im Sinn hat. Argumentativ ist der sogenannte Analogieschluss dabei als einzelnes keine stabile Brücke, sondern vermutlich ein Baustein in einem möglicherweise kohärenten Bauwerk, das von der (hier nicht diskutierten) Leib-Wille-Identität zur Welt-Wille-Identität führt.
Der Exkurs zu dem Fremdpsychischen ist dabei nützlich, weil die Frage nach dem An-sich anderer Objekte in der Vorstellung bereits auf verschiedene Arten gestellt und beantwortet wurde. Sowohl bei Schopenhauers Problemstellung als auch bei der Frage nach dem Fremdpsychischem steht ein Subjekt vor Objekten, die als subjekthafte Wesen oder aber als bloße Objekte verstanden werden können. Ein Analogieschluss im Falle der Stelle in § 19 W I erinnert daher an Analogieargumente für Fremdpsychisches. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, dass die Basis an Ähnlichkeiten für Fremdpsyche-Argumente größer ist und eine weniger weitreichende Aussage begründet werden soll. Schopenhauer möchte nicht nur für Mitmenschen (oder Tiere), sondern für alle Objekte eine Aussage treffen und minimiert damit auch die formal hilfreiche Menge an Gemeinsamkeiten zwischen Leib und anderen Objekten. Je kleiner die Ähnlichkeit ist, desto schwächer ist ein Analogieschluss. Daher ist ein formal guter Analogieschluss nach gängigen Kriterien auch nicht möglich und ein formal guter Analogieschluss ist auch nicht denkbar. Zu berücksichtigen ist auch, dass selbst die weniger weitreichenden Analogieschlüsse für Fremdpsychisches unter der Schwäche leiden, von bloß einem Objekt auszugehen.
Demnach sollte man den sog. Analogieschluss zunächst nur als ein Puzzleteil von Schopenhauers Argumentation für die Welt-Wille-Identität sehen, als eine Analogie-Hypothese, die sich nicht bestätigt, aber als sinnvolle Deutung in einem kohärenten Kontext von Aussagen über menschliche Erfahrungen erweisen kann.
Zweiter Teil: Alternative Argumente
Mitleid als Form der Erkenntnis?
Im zweiten Teil geht es zunächst um das Mitleid und die Frage, ob Schopenhauer damit dafür zu argumentieren versucht, dass das Wesen des Menschen und anderer Dinge der Vorstellung dasselbe ist.
Nach Beisel hat das Mitleid in Schopenhauers Philosophie eine metaphysische Funktion und ist eine Form der Erkenntnis. Über das Mitleid erhalte der Mitleidende Einsicht in den Willen als das Wesen aller Dinge.[152]
„Beim Mitleid in seiner metaphysischen Funktion handelt es sich, wie hier ausgeführt wurde, also um eine Form der Erkenntnis, die es ermöglicht, das principium individuationis zu durchschauen und die substanziale Selbigkeit der Dinge in der Welt der Erscheinung bzw. Vorstellung zu erkennen.; die Verschiedenheit zwischen dem Mitleidenden und seiner Umwelt wird als lediglich phänomenal und nicht wesentlich durchschaut und das wahre Wesen wird im Gefühl des Mitleids als Einheit der Welt erkannt. Diese Erkenntnis erfolgt unmittelbar intuitiv und nicht abstrakt, sie ist ‚nicht wegzuräsonniren und nicht anzuräsonniren‘ und lässt sich daher auch nicht mitteilen oder lehren, sondern muss in jedem Menschen einzeln aufgehen und ihren Ausdruck nicht in Worten, sondern in Taten und Handeln finden.“[153]
Demnach ist es Menschen durch Mitleid möglich, Kenntnis von der Welt-Wille-Identität zu erlangen, wenn man den Willen zunächst bloß als gemeinsames Wesen versteht und keine weiteren Attribute zuschreibt. Das pricipium individuationis, also die durch Raum, Zeit und Kausalität geprägte Vorstellung, wird durchschaut. An dieser Stelle ist es notwendig, Schopenhauer zur Klärung des Begriffs zu zitieren:
„Schon die allgemeinste Form aller Vorstellung, die des Objekts für ein Subjekt, trifft ihn nicht; noch weniger die dieser untergeordneten, welche insgesammt ihren gemeinschaftlichen Ausdruck im Satz vom Grunde haben, wohin bekanntlich auch Zeit und Raum gehören, und folglich auch die durch diese allein bestehende und möglich gewordene Vielheit. In dieser letztern Hinsicht werde ich, mit einem aus der alten eigentlichen Scholastik entlehnten Ausdruck, Zeit und Raum das principium individuationis nennen, welches ich ein für alle Mal zu merken bitte. Denn Zeit und Raum allein sind es, mittelst welcher das dem Wesen und dem Begriff nach Gleiche und Eine doch als verschieden, als Vielheit neben und nach einander erscheint: sie sind folglich das principium individuationis, der Gegenstand so vieler Grübeleien und Streitigkeiten der Scholastiker, welche man im Suarez (Disp. 5, sect. 3) beisammen findet. – Der Wille als Ding an sich liegt, dem Gesagten zufolge, außerhalb des Gebietes des Satzes vom Grund in allen seinen Gestaltungen, und ist folglich schlechthin grundlos, obwohl jede seiner Erscheinungen durchaus dem Satz vom Grunde unterworfen ist: er ist ferner frei von aller Vielheit, obwohl seine Erscheinungen in Zeit und Raum unzählig sind: er selbst ist Einer: jedoch nicht wie ein Objekt Eines ist, dessen Einheit nur im Gegensatz der möglichen Vielheit erkannt wird: noch auch wie ein Begriff Eins ist, der nur durch Abstraktion von der Vielheit entstanden ist: sondern er ist Eines als das, was außer Zeit und Raum, dem principio individuationis, d.i. der Möglichkeit der Vielheit, liegt. Erst wenn uns dieses alles durch die folgende Betrachtung der Erscheinungen und verschiedenen Manifestationen des Willens völlig deutlich geworden seyn wird, werden wir den Sinn der Kantischen Lehre völlig verstehen, daß Zeit, Raum und Kausalität nicht dem Dinge an sich zukommen, sondern nur Formen des Erkennens sind.“[154]
Mit dem Mitleid wird also die Täuschung von Raum und Zeit überwunden und Menschen erkennen, dass die Vielheit, in der sich Menschen als Objekte (Leib) wiederfinden, nur ein Schein ist. Diese Kenntnis erlangen Menschen, sobald sie einmal Mitleid empfunden haben. Dabei betont Beisel auch, dass Mitfreude nicht ausreicht,[155] sodass die übliche englische Übersetzung für Schopenhauers „Mitleid“, „compassion“ („Mitgefühl“),[156] vermutlich nicht die beste Übersetzung ist, sondern „pity“. Wie Beisel mit Verweis auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu Spiegelneuronen erkennt, ist nicht bei jedem Menschen die Fähigkeit zum Mitleiden gleich. Beispielsweise ist Mitleid trainierbar.[157] Ist nicht damit auch ein Unterschied hinsichtlich der Fähigkeit über das Mitleid zur Überwindung der Täuschung der Vorstellung gegeben? Auch Schopenhauer beschreibt jedenfalls, dass nicht alle Menschen in gleichem Maße Mitleid zu empfinden scheinen:
„[…] und seinen treuesten Freund, den so intelligenten Hund, legt er an die Kette! Nie sehe ich einen solchen ohne inniges Mitleid mit ihm und tiefe Indignation gegen seinen Herrn, und mit Befriedigung denke ich an den vor einigen Jahren, von den Times berichteten Fall, daß ein Lord, der einen großen Kettenhund hielt, einst seinen Hof durchschreitend, sich beigehn ließ, den Hund liebkosen zu wollen, worauf dieser sogleich ihm den Arm von oben bis unten aufriß, – mit Recht! er wollte damit sagen: »Du bist nicht mein Herr, sondern mein Teufel, der mir mein kurzes Daseyn zur Hölle macht.«“[158]
Außerdem stellt sich die Frage, wessen Leid bei Menschen Mitleid auslöst. Hier muss Schopenhauer auch außerhalb seiner vierten Klasse von Objekten potenzielle Auslöser von Mitleid sehen. Sonst könnte er nicht zum Vergleich der Empfindungen von Tieren auffordern:
„Wer die Behauptung, daß, in der Welt, der Genuß den Schmerz überwiegt, oder wenigstens sie einander die Waage halten, in der Kürze prüfen will, vergleiche die Empfindung des Thieres, welches ein anderes frißt, mit der dieses andern.“[159]
Dazu spricht Schopenhauer explizit vom Mitleid mit allen lebenden Wesen:
„Denn gränzenloses Mitleid mit allen lebenden Wesen ist der festeste und sicherste Bürge für das sittliche Wohlverhalten und bedarf keiner Kasuistik.“[160]
Dass mit „allen lebenden Wesen“ alle Objektklassen außer der ersten Klasse der unbelebten Natur gemeint ist, erscheint wenig plausibel. Wird durch das einmalige Fühlen von Mitleid erkannt, dass alle Objekte der Vorstellung an sich dasselbe sind oder ist das Mitfühlen der Moment, in dem bloß der Mitleidende zu dem Leidenden keine Grenze mehr sieht? Schließt der Mitleidende dann von dieser Erfahrung induktiv darauf, dass alle Wesen dieser Objektklasse oder gar alle Objekte überhaupt an sich dasselbe sind? Falls über das Mitleid nur die naheliegende, intuitive Erkenntnis, dass biologisch verwandte Lebewesen „ihrem Wesen“ nach oder „an sich“ eine größere Ähnlichkeit haben, hätte das Mitleid als Alternative zum Analogieschluss keinen großen Wert, da Schopenhauer für den Willen als Ding an sich aller Objekte argumentieren will, weswegen auch die Fremdpsyche-Analogieschlüsse nicht hilfreich waren. Die Frage ist, ob Mitleid mit allen lebenden Wesen oder nur mit Menschen und einigen Tierarten möglich ist.
Zwei weitere Fragen ergeben sich: Nach Beisel liefert Schopenhauer keine Antwort darauf, wieso fremdes Leid beim Mitleiden als fremdes und nicht als eigenes Leid wahrgenommen wird.[161] Auch Schopenhauer unterscheidet eigenes und fremdes Leid. Auch durch Mitleid bleibt dieser Unterschied bestehen.[162] Wieso wird fremdes Leid als solches wahrgenommen und durchbricht dennoch die Täuschung der Vorstellung?
Betrifft das Mitleid als „Form der Erkenntnis“[163] nur Menschen? Aus wissenschaftlicher Sicht sind „Affen“, wie Beiser schreibt, mittels Spiegelneuronen dafür genauso ausgestattet.[164] Da Schopenhauer das Mitleid nach Beiser nicht zu einer Sache der Vernunft und eben nicht abstrakt macht, müssten Affen gleichermaßen das Verstandesprodukt, pricipium individuationis, durchschauen können.
Zur Beantwortung dieser Fragen muss überprüft werden, auf welche Textstellen Beiser sich stützt und welchen Wert diese für die argumentative Brücke zur Welt-Wille-Identität haben. Beisel stützt sich in erster Linie auf § 66 in W I, ausschließlich sogar, soweit es um Mitleid als Erkenntnis geht.[165]
Die erste Textstelle des § 66 W I, in der das Durchschauen des principii individuationis bzw. des Schleiers der Maja, ein Konzept aus den Veden, das er der Vorstellung gleichsetzt,[166] betrifft den gerecht Handelnden:
„Wir sehen nun, daß einem solchen Gerechten, schon nicht mehr, wie dem Bösen, das principium individuationis eine absolute Scheidewand ist, daß er nicht, wie jener, nur seine eigene Willenserscheinung bejaht und alle anderen verneint, daß ihm Andere nicht bloße Larven sind, deren Wesen von dem seinigen ganz verschieden ist; sondern durch seine Handlungsweise zeigt er an, daß er sein eigenes Wesen, nämlich den Willen zum Leben als Ding an sich, auch in der fremden, ihm bloß als Vorstellung gegebenen Erscheinung wiedererkennt, also sich selbst in jener wiederfindet, bis auf einen gewissen Grad, nämlich den des Nicht-Unrechtthuns, d.h. Nichtverletzens. In eben diesem Grade nun durchschaut er das principium individuationis, den Schleier der Maja: er setzt sofern das Wesen außer sich dem eigenen gleich: er verletzt es nicht.“[167]
Schopenhauer unterscheidet darin den Gerechten vom Bösen, davon auszugehen, dass sie dem Wesen nach eins sind. Wer nicht gerecht handelt, ist also noch durch die Vorstellung, das principium individuationis bzw. den Schleier der Maja getäuscht:
„Wir haben gefunden, daß die freiwillige Gerechtigkeit ihren innersten Ursprung hat in einem gewissen Grad der Durchschauung des principii individuationis, während in diesem der Ungerechte ganz und gar befangen bleibt.“[168]
Wie aber Menschen zu dieser intuitiven Erkenntnis gelangen, findet sich dort noch nicht.
Am Beispiel eines edel handelnden Menschen schreibt Schopenhauer, dass Mitleid zu einer Erkenntnis führt:
„Wenn eben dieser Unterschied, in den Augen manches Andern, so groß ist, daß fremdes Leiden dem Boshaften unmittelbare Freude, dem Ungerechten ein willkommenes Mittel zum eigenen Wohlseyn ist; wenn der bloß Gerechte dabei stehen bleibt, es nicht zu verursachen; wenn überhaupt die meisten Menschen unzählige Leiden Anderer in ihrer Nähe wissen und kennen, aber sich nicht entschließen sie zu mildern, weil sie selbst einige Entbehrung dabei übernehmen müßten; wenn also Jedem von diesen Allen ein mächtiger Unterschied obzuwalten scheint zwischen dem eigenen Ich und dem fremden; so ist hingegen jenem Edlen, den wir uns denken, dieser Unterschied nicht so bedeutend; das principium individuationis, die Form der Erscheinung, befängt ihn nicht mehr so fest; sondern das Leiden, welches er an Anderen sieht, geht ihn fast so nahe an, wie sein eigenes: er sucht daher das Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen, versagt sich Genüsse, übernimmt Entbehrungen, um fremde Leiden zu mildern. Er wird inne, daß der Unterschied zwischen ihm und Anderen, welcher dem Bösen eine so große Kluft ist, nur einer vergänglichen täuschenden Erscheinung angehört: er erkennt, unmittelbar und ohne Schlüsse, daß das Ansich seiner eigenen Erscheinung auch das der fremden ist, nämlich jener Wille zum Leben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in Allem lebt; ja, daß dieses sich sogar auf die Thiere und die ganze Natur erstreckt: daher wird er auch kein Thier quälen.“[169]
Dem Edlen ist der Unterschied zwischen dem eigenen Ich und dem fremden Ich nicht so groß und er fühlt das Leid anderer Menschen fast so sehr wie sein eigenes. Er fühlt also Mitleid, durchschaut die Vorstellung und macht zwischen sich und anderen Menschen keinen großen Unterschied. Eine zeitliche Reihenfolge oder gar eine Kausalität wird daraus noch nicht sichtbar. Aber „er wird inne“, aufgrund des Mitleids, dass die Erscheinung/Vorstellung bloß eine Täuschung ist:
„das Leiden, welches er an Anderen sieht, geht ihn fast so nahe an, wie sein eigenes: er sucht daher das Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen, versagt sich Genüsse, übernimmt Entbehrungen, um fremde Leiden zu mildern. Er wird inne, daß der Unterschied zwischen ihm und Anderen, welcher dem Bösen eine so große Kluft ist, nur einer vergänglichen täuschenden Erscheinung angehört“[170]
Ohne Schlüsse und ganz unmittelbar erkennt er es für Menschen, auch Tiere und sogar die gesamte Natur, in dem Sinne wohl auch der anorganischen. Ist es plausibel, dass Mitleid diese Erkenntnis auslöst? Während Mitleid als ein Phänomen von Menschen als Reaktion auf Leid von Mitmenschen oder auch einigen Tieren bekannt ist, so scheint Mitleid von destruktiven Einwirkungen auf Pflanzen oder von Erosion nicht ausgelöst zu werden. Von Mitleid ist zudem nur dann sinnvoll zu sprechen, wenn es ein leidendes, auch zwingend leidfähiges anderes Individuum gibt. Damit scheiden zumindest zwei Klassen von Objekten bei Schopenhauer aus, außerdem vermutlich noch einige Tiere. Auch Schopenhauer sieht in der Tierwelt unterschiedliche Grade der Leidfähigkeit:
„Das Recht des Menschen auf das Leben und die Kräfte der Thiere beruht darauf, daß, weil mit der Steigerung der Klarheit des Bewußtseyns das Leiden sich gleichmäßig steigert, der Schmerz, welchen das Thier durch den Tod, oder die Arbeit leidet, noch nicht so groß ist, wie der, welchen der Mensch durch die bloße Entbehrung des Fleisches, oder der Kräfte des Thieres leiden würde, der Mensch daher in der Bejahung seines Daseyns bis zur Verneinung des Daseyns des Thieres gehen kann, und der Wille zum Leben im Ganzen dadurch weniger Leiden trägt, als wenn man es umgekehrt hielte. Dies bestimmt zugleich den Grad des Gebrauchs, den der Mensch ohne Unrecht von den Kräften der Thiere machen darf, welchen man aber oft überschreitet, besonders bei Lastthieren und Jagdhunden; wogegen daher die Thätigkeit der Thier-Schutz-Gesellschaften besonders gerichtet ist. Auch erstreckt jenes Recht, meiner Ansicht nach, sich nicht auf Vivisektionen, zumal der oberen Thiere. Hingegen leidet das Insekt durch seinen Tod noch nicht so viel, wie der Mensch durch dessen Stich.“[171]
In der Pflanzenwelt gibt es dagegen keine Leidfähigkeit,[172] sie ist vollkommen frei von Schmerzen:
„In der Pflanze ist noch keine Sensibilität, also kein Schmerz: ein gewiß sehr geringer Grad von Leiden wohnt den untersten Thieren, den Infusorien und Radiarien ein: sogar in den Insekten ist die Fähigkeit zu empfinden und zu leiden noch beschränkt: erst mit dem vollkommenen Nervensystem der Wirbelthiere tritt sie in hohem Grade ein, und in immer höherem, je mehr die Intelligenz sich entwickelt.“[173]
Wenn also nur wenige Objekte der Vorstellung Mitleid erregen, wieso sollte man dann durch Mitleid zu einer Kenntnis über ganz andere Objekte (anderer Klassen) gelangen? Dies ist eine Disanalogie zu einer gedachten Induktion, nämlich der, dass von einem Erlebnis mit einem leidenden Lebewesen auf Eigenschaften anderer Lebewesen geschlossen wird. Bei Schopenhauer findet die Erkenntnis aus dem Mitleid ohne Schluss statt und auch der Einfluss prägender Erfahrungen mit einem Lebewesen auf das eigene Verhalten anderen gegenüber ist ohne Vernunft denkbar. Unbewusst prägt eine intensive Interaktion mit einem Lebewesen auch die Sicht auf andere Lebewesen. Auch ohne Schlüsse kann beispielsweise eine positive Erfahrung mit einem vermeintlich gefährlichen Tier die Einstellung zu allen Tieren dieser Art verändern. Auch dann könnte man von einer Erkenntnis sprechen. Dass diese Erkenntnis sich ausweitet auf wesentlich mehr Tierarten oder gar Objektarten ist aber unwahrscheinlich. Daher scheint es insgesamt unplausibel, dass eine Mitleidserfahrung für den Mitleidenden nicht nur die Grenzen zwischen Mitleidendem und Leidenden (oder vielleicht noch seiner Tierart) verschwimmt, sondern über diese Grenze hinaus auch die Grenzen der leidfähigen Objekte der Vorstellung.
Nach Schopenhauer folgt nicht nur, wie oben beschrieben, aus dem Mitleid die Erkenntnis, sondern diese Erkenntnis hat auch gute Taten zur Folge, die wiederum durch die Befriedigung des guten Gewissens die Erkenntnis bestätigt:
„Das Gegentheil der Gewissenspein, deren Ursprung und Bedeutung oben erläutert worden, ist das gute Gewissen, die Befriedigung, welche wir nach jeder uneigennützigen That verspüren. Sie entspringt daraus, daß solche That, wie sie hervorgeht aus dem unmittelbaren Wiedererkennen unseres eigenen Wesens an sich auch in der fremden Erscheinung, uns auch wiederum die Beglaubigung dieser Erkenntniß giebt, der Erkenntniß, daß unser wahres Selbst nicht bloß in der eigenen Person, dieser einzelnen Erscheinung, da ist, sondern in Allem was lebt.“[174]
Neben den zitierten Textstellen in § 66 von Die Welt als Wille und Vorstellung sind in § 16 der Preisschrift über die Grundlage der Moral hilfreiche Hinweise zum Verständnis von Schopenhauers Mitleidsbegriff. Er fragt sich, wie das Wohl und Wehe anderer Menschen handlungsmotivierend für einen selbst werden können:
„Offenbar nur dadurch, daß jener Andere der letzte Zweck meines Willens wird, ganz so wie sonst ich selbst es bin: also dadurch, daß ich ganz unmittelbar sein Wohl will und sein Wehe nicht will, so unmittelbar, wie sonst nur das meinige. Dies aber setzt nothwendig voraus, daß ich bei seinem Wehe als solchem geradezu mit leide, sein Wehe fühle, wie sonst nur meines, und deshalb sein Wohl unmittelbar will, wie sonst nur meines. Dies erfordert aber, daß ich auf irgend eine Weise mit ihm identificirt sei, d.h. daß jener gänzliche Unterschied zwischen mir und jedem Andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in einem gewissen Grade aufgehoben sei. Da ich nun aber doch nicht in der Haut des Andern stecke, so kann allein vermittelst der Erkenntniß, die ich von ihm habe, d.h. der Vorstellung von ihm in meinem Kopf, ich mich so weit mit ihm identificiren, daß meine That jenen Unterschied als aufgehoben ankündigt. Der hier analysirte Vorgang aber ist kein erträumter, oder aus der Luft gegriffener, sondern ein ganz wirklicher, ja, keineswegs seltener: es ist das alltägliche Phänomen des Mitleids, d.h. der ganz unmittelbaren, von allen anderweitigen Rücksichten unabhängigen Theilnahme zunächst am Leiden eines Andern und dadurch an der Verhinderung oder Aufhebung dieses Leidens, als worin zuletzt alle Befriedigung und alles Wohlseyn und Glück besteht. […] Sobald dieses Mitleid rege wird, liegt mir das Wohl und Wehe des Andern unmittelbar am Herzen, ganz in der selben Art, wenn auch nicht stets in dem selben Grade, wie sonst allein das meinige: also ist jetzt der Unterschied zwischen ihm und mir kein absoluter mehr.“[175]
Nach Schopenhauer schafft die Mitleidserfahrung eine Identifikation, die über die bloße Wahrnehmung (möglicher äußerlicher Ähnlichkeiten) hinausgeht. Dadurch werden fremde Leiden für den Mitleidserfahrenen beinahe so motivierend wie eigene Leiden.
Wie genau Mitleid wirkt und die Verbindung zwischen Mitleidendem und Leidendem schafft, bezeichnet Schopenhauer in der Preisschrift. Die Antwort auf die Frage nach dem Mitleid sei eine metaphysische Spekulation:
„Er ist, in Wahrheit, das große Mysterium der Ethik, ihr Urphänomen und der Gränzstein, über welchen hinaus nur noch die metaphysische Spekulation einen Schritt wagen kann.“[176]
Der 17. Paragraph präzisiert Schopenhauer den Zusammenhang von Mitleid und Erkenntnis:
„Jedoch ist keineswegs erforderlich, daß in jedem einzelnen Fall das Mitleid wirklich erregt werde; wo es auch oft zu spät käme: sondern aus der Ein für alle Mal erlangten Kenntniß von dem Leiden, welches jede ungerechte Handlung nothwendig über Andere bringt, und welches durch das Gefühl des Unrechterduldens, d.h. der fremden Uebermacht, geschärft wird, geht in edeln Gemüthern die Maxime neminem laede hervor, […]“[177]
Sobald einmal Mitleid empfunden wurde, ist der Schleier der Maja durchbrochen und man hat Kenntnis vom gemeinsamen Wesen der Objekte – jedenfalls der Lebewesen, da nur sie leidensfähig sind. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wieso fremdes Leid für diese Kenntnis überhaupt notwendig sein sollte, bzw., ob eigenes Leid für diese Kenntnis nicht bereits ausreichen würde: Mit Bertrand Russels Analogieschluss könnte man argumentieren, dass ein gleiches Ereignis, bspw. der Schlag mit einem Hammer neben den verfehlten Nagel auf den Daumen, eine gleiche äußerlich sichtbare Reaktion, etwa ein schmerzverzogenes Gesicht oder ein Schrei, zur Folge hat, sowohl bei einem selbst als auch bei anderen Menschen. Man könnte darauf schließen, dass die anderen Menschen die gleichen psychischen Zustände in den gleichen Situationen haben, und hat sich damit fremdes Leid erschlossen. Schopenhauer formuliert selbst:
„Alle Handlungen und Gebehrden der Thiere, welche Bewegungen des Willens ausdrücken, verstehen wir unmittelbar aus unserm eigenen Wesen; daher wir, so weit, auf mannigfaltige Weise mit ihnen sympathisiren.“[178]
Damit braucht Schopenhauer das Mitleid nicht, um unmittelbare Kenntnis vom Wesen anderer Tiere zu erhalten, sondern vollzieht implizit Russels Analogieschluss. Ähnlich wie beim Mitleid ist nach Schopenhauer auch hier die Erkenntnis unmittelbar, wohl im Sinne von unbewusst. Dieses Beobachten von anderen Tieren, das zur Erkenntnis des Willens als gemeinsames Ding an sich führt, kann natürlich auch als Mitleid verstanden werden. Schließlich ist für Schopenhauer Leben wesentlich Leiden.[179] Dieses verursacht der Wille, dessen Wirken wir in eigenen Handlungen beobachten können,[180] sowie wir nach Schopenhauer auch Tiere verstehen bzw. uns erklären können.
Vier Probleme bleiben: Erstens folgt aus einer Mitleidserfahrung oder der daraus folgenden stärkeren Identifikation mit anderen Lebewesen, die höhere Tiere bzw. Menschen sein können, nicht zwingend eine metaphysische Erkenntnis. Sich verbunden fühlen kann aus heutiger Sicht ein rein psychologisches Phänomen sein. Auch wer „für sein Vaterland in den Tod geht“[181] ist nicht notwendigerweise eine metaphysische Erkenntnis reicher und von einer Täuschung befreit.
Zweitens kann die Erfahrung von fremden Leid und Mitleid kaum moralisch guten Menschen exklusiv sein. Zumindest mit den Menschen, die einem am nächsten sind, fühlt man mit, sodass alle Menschen die Folgen des einmaligen Mitleidens spüren müssten und damit diese Erkenntnisse haben sollten. Mitleid empfinden kann schließlich, so Schopenhauer, jeder:
„Der wirksamste Trost, bei jedem Unglück, in jedem Leiden, ist, hinzusehn auf die Andern, die noch unglücklicher sind, als wir: und dies kann Jeder.“[182]
Drittens ist es wenig plausibel, dass der Mitleidende daraus Gedanken und Einstellungen über andere Objektarten als den leidempfänglichen Objekten entwickelt. Schließlich wird Mitleid als etwas Menschliches wahrgenommen, wodurch Mitmenschen für uns nicht nur besondere Objekte unter Objekten oder besondere Lebewesen unter Lebewesen sind,[183] wenngleich Mitleid auch mit Tieren weitverbreitet ist.[184]
Viertens kann das Empfinden von Mitleid auch in die Irre führen. Man kann Mitleid mit jemandem empfinden, der überhaupt kein Leid empfindet.[185] Ebenso ist es denkbar, dass man kein Mitleid mit einem Leidenden empfindet. Damit erscheint es schwierig von einer Erkenntnisform zu sprechen, in jedem Fall ist es jedoch keine sichere.
Womöglich dient die spekulative Metaphysik dem Mitleid genauso als hypothetische Erklärung wie das Mitleid selbst auch eine Stütze für Schopenhauers Willensmetaphysik ist. Wir empfinden Mitleid, weil wir Eins sind; und weil wir Mitleid empfinden, können wir uns als Eins begreifen.
In der Literatur wird das Mitleid nicht bloß als Erkenntnisform und solides Fundament der Willensmetaphysik wahrgenommen, sondern beispielsweise von Juhos scharf kritisiert: Er bezeichnet Schopenhauers Thesen über das Mitleid als eine „spekulativ-mythologische Deutung des Mitleids“[186].
Das Mitleid sei bei Schopenhauer eine unmittelbare, gefühlsmäßige Erkenntnis der Einheit von Leidendem und Bemitleidetem, so Hallich. Dafür benötige er die Prämissen seiner Willensmetaphysik.[187] Hallich meint, dass nicht leicht ersichtlich ist, das Subjekt andere Menschen wahrnehmen soll, wenn dies nicht als Erscheinung geschehe. Schließlich bestehe das Mitleid im Durchschauen des Individuationsprinzips. Er diskutiert die Möglichkeit, ob im Mitleid die Idee von anderen analog zur ästhetischen Anschauung wahrgenommen werden kann. Dies scheint Hallich wenig plausibel, da die ästhetische Anschauung interesselos ist.[188] Das Mitleid hat schließlich eine motivationale Rolle.
Heilige
Schopenhauer spricht Heiligen eine unmittelbare Erkenntnis des Dinges an sich zu. Daraus, dass die Wesen der Vorstellung nicht bloß als Individuen betrachtet werden, sondern ihr gemeinsames Wesen erkannt wird, ergibt sich die bei Schopenhauer bedeutsame Willensverneinung.
„Und was ich hier mit schwacher Zunge und nur in allgemeinen Ausdrücken geschildert habe, ist nicht etwan ein selbsterfundenes philosophisches Mährchen und nur von heute: nein, es war das beneidenswerthe Leben gar vieler Heiligen und schöner Seelen unter den Christen, und noch mehr unter den Hindus und Buddhaisten, auch unter anderen Glaubensgenossen. So sehr verschiedene Dogmen auch ihrer Vernunft eingeprägt waren, sprach dennoch sich die innere, unmittelbare, intuitive Erkenntniß, von welcher allein alle Tugend und Heiligkeit ausgehen kann, auf die gleiche und nämliche Weise durch den Lebenswandel aus. Denn auch hier zeigt sich der in unserer ganzen Betrachtung so wichtige und überall durchgreifende, bisher zu wenig beachtete, große Unterschied zwischen der intuitiven und der abstrakten Erkenntniß. Zwischen beiden ist eine weite Kluft, über welche, in Hinsicht auf die Erkenntniß des Wesens der Welt, allein die Philosophie führt. Intuitiv nämlich, oder in concreto, ist sich eigentlich jeder Mensch aller philosophischen Wahrheiten bewußt: sie aber in sein abstraktes Wissen, in die Reflexion zu bringen, ist das Geschäft des Philosophen, der weiter nichts soll, noch kann.“[189]
Wie diese intuitive und unmittelbare Erkenntnis der Heiligen zustande kommt, erläutert Schopenhauer nicht. Es erinnert allerdings an das Mitleid,[190] bei dem Schopenhauer auch von einer unmittelbaren Erkenntnis spricht. Das Heiligsein ist auf Mitleid aufgebaut: „Ihm ist kein Leiden mehr fremd.“[191] Man wird heilig durch Taten, diese wiederum sind auf intuitiver Erkenntnis gegründet:
„Es war also kein Dogma, keine abstrakte Erkenntniß, die sie dabei leitete; sondern eine unmittelbare und intuitive. Vielmehr waren ihrer Vernunft grundverschiedene Dogmen eingeprägt: aber ihr Lebenswandel sprach auf die gleiche und nämliche Weise jene innre, unmittelbare und intuitive Erkenntniß aus, von welcher allein alle Tugend und endlich auch alle Heiligkeit ausgehn kann.“[192]
Daher gelten für „Heilige“ dieselben Probleme, die mit Blick auf das Mitleid oben dargestellt sind.
Künstler
Schopenhauer scheint Platons Ideen und Kants Ding an sich gleichzusetzen:
„Aber man stritt und streitet und spottet über die Hauptlehren beider, über Platons Ideen und Kants Ding an sich: daß aber diese beiden Eins und dasselbe sind, ist so unerhört als gewiß.“[193]
Da Schopenhauer dem Künstler die Fähigkeit zuspricht, Ideen zu erkennen, könnte darauf geschlossen werden, dass Künstler das Ding an sich, also den einen Willen als metaphysische Gemeinsamkeit aller Dinge der Vorstellung erkennen können. Allerdings unterscheidet Schopenhauer bei aller Ähnlichkeit zwischen Ding an sich und Idee. Das Ding an sich (=der Wille) ist frei von Formen, während die Idee eine erkennbare Form in der Vorstellung ist:[194]
„In Folge unserer bisherigen Betrachtungen ist uns, bei aller innern Uebereinstimmung zwischen Kant und Platon, und der Identität des Zieles, das beiden vorschwebte, oder der Weltanschauung, die sie zum Philosophiren aufregte und leitete, dennoch Idee und Ding an sich nicht schlechthin Eines und dasselbe: vielmehr ist uns die Idee nur die unmittelbare und daher adäquate Objektität des Dinges an sich, welches selbst aber der Wille ist, der Wille, sofern er noch nicht objektivirt, noch nicht Vorstellung geworden ist.“[195]
Was der Künstler erkennt, ist bloß die Idee, nicht das Ding an sich, nicht den einen Willen „als den Kern aller Wesen“[196] und somit kann auch der Künstler mit keiner Form der Erkenntnis als Ersatz für den vermeintlichen Analogieschluss dienen. Das Erkennen der Ideen scheint sogar vielmehr eine Abstraktion zu sein, für die Schopenhauer Phantasie voraussetzt:
„Man hat als einen wesentlichen Bestandtheil der Genialität die Phantasie erkannt, ja, sie sogar bisweilen für mit jener identisch gehalten: ersteres mit Recht; letzteres mit Unrecht. Da die Objekte des Genius als solchen die ewigen Ideen, die beharrenden wesentlichen Formen der Welt und aller ihrer Erscheinungen sind, die Erkenntniß der Idee aber nothwendig anschaulich, nicht abstrakt ist; so würde die Erkenntniß des Genius beschränkt seyn auf die Ideen der seiner Person wirklich gegenwärtigen Objekte und abhängig von der Verkettung der Umstände, die ihm jene zuführten, wenn nicht die Phantasie seinen Horizont weit über die Wirklichkeit seiner persönlichen Erfahrung erweiterte und ihn in den Stand setzte, aus dem Wenigen, was in seine wirkliche Apperception gekommen, alles Uebrige zu konstruiren und so fast alle möglichen Lebensbilder an sich vorübergehen zu lassen. Zudem sind die wirklichen Objekte fast immer nur sehr mangelhafte Exemplare der in ihnen sich darstellenden Idee: daher der Genius der Phantasie bedarf, um in den Dingen nicht Das zu sehen, was die Natur wirklich gebildet hat, sondern was sie zu bilden sich bemühte, aber, wegen des im vorigen Buche erwähnten Kampfes ihrer Formen unter einander, nicht zu Stande brachte“[197]
Unabhängig davon, dass der Künstler nicht das Ding an sich, sondern nur die Ideen anschaut, verrät Schopenhauer nicht, wie die Anschauung vonstattengeht.[198] Diese findet einfach unbewusst und instinktmäßig statt.[199] Argumente für die Willensmetaphysik lassen sich jedenfalls keine finden.
Analogon
Eine wesentlich schwächere und daher hier deutlich kürzer dargestellte Möglichkeit Schopenhauers, für seine Willensmetaphysik zu argumentieren, ist die „analogische[] Beziehung zwischen verschiedenen Stufen der Willensobjektivierung“[200] bzw. das Analogon. Wesentlich schwächer als Argument sind diese Beziehungen, weil sie bloß als Teil einer Deutung der Erfahrungswelt dienen und nicht explizit als metaphysisches Argument gebraucht werden. Darzustellen ist dies dennoch, weil sie als Teil einer möglichen Deutung die Kernfrage der Arbeit mitbeantworten. Im Idealfall liefert Schopenhauers Willensmetaphysik eine Deutung aller Phänomene in der Vorstellung und erklärt diese plausibel.
Schopenhauer begreift den einen metaphysischen Willen als einen blinden, stets wollenden Drang, der sich in der Vorstellung vierstufig als unbelebte Natur, Pflanzen, Tiere und Menschen objektiviert und durch diese Vielheit über das eigene gemeinsame Wesen getäuscht ist.
„So sähen wir denn hier, auf der untersten Stufe, den Willen sich darstellen als einen blinden Drang, ein finsteres, dumpfes Treiben, fern von aller unmittelbaren Erkennbarkeit. Es ist die einfachste und schwächste Art seiner Objektivation. Als solcher blinder Drang und erkenntnißloses Streben erscheint er aber noch in der ganzen unorganischen Natur, in allen den ursprünglichen Kräften, welche aufzusuchen und ihre Gesetze kennen zu lernen, Physik und Chemie beschäftigt sind, und jede von welchen sich uns in Millionen ganz gleichartiger und gesetzmäßiger, keine Spur von individuellem Charakter ankündigender Erscheinungen darstellt, sondern bloß vervielfältigt durch Zeit und Raum, d.i. durch das principium individuationis, wie ein Bild durch die Facetten eines Glases vervielfältigt wird.“[201]
Daraus folgt ein Streit zwischen den Objektivationen um Materie. Aus dem Streit niedriger Objektivationen entstehen höhere, die wiederum um Materie streiten, aber auch Ähnlichkeit mit der niederen Stufe behält.[202] Für Schopenhauer bauen die Objektivationsstufen auch metaphysisch aufeinander auf. In der Idee des Menschen findet sich die Idee des Tieres:
„[Der eine Wille] allein ist das Ding an sich: alles Objekt aber ist Erscheinung, Phänomen, in Kants Sprache zu reden. – Obgleich im Menschen, als (Platonischer) Idee, der Wille seine deutlichste und vollkommenste Objektivation findet; so konnte dennoch diese allein sein Wesen nicht ausdrücken. Die Idee des Menschen durfte, um in der gehörigen Bedeutung zu erscheinen, nicht allein und abgerissen sich darstellen, sondern mußte begleitet seyn von der Stufenfolge abwärts durch alle Gestaltungen der Thiere, durch das Pflanzenreich, bis zum Unorganischen: sie alle erst ergänzen sich zur vollständigen Objektivation des Willens; sie werden von der Idee des Menschen so vorausgesetzt, wie die Blüthen des Baumes Blätter, Aeste, Stamm und Wurzel voraussetzen: sie bilden eine Pyramide, deren Spitze der Mensch ist.“[203]
Diese metaphysische Spekulation oder Deutung sieht Schopenhauer dadurch bestätigt, dass Eigenschaften niedriger Objektivationen in den Eigenschaften höherer Objektivationen zu finden sind:
„Wenn von den Erscheinungen des Willens, auf den niedrigeren Stufen seiner Objektivation, also im Unorganischen, mehrere unter einander in Konflikt gerathen, indem jede, am Leitfaden der Kausalität, sich der vorhandenen Materie bemächtigen will; so geht aus diesem Streit die Erscheinung einer höhern Idee hervor, welche die vorhin dagewesenen unvollkommeneren alle überwältigt, jedoch so, daß sie das Wesen derselben auf eine untergeordnete Weise bestehen läßt, indem sie ein Analogon davon in sich aufnimmt; welcher Vorgang eben nur aus der Identität des erscheinenden Willens in allen Ideen und aus seinem Streben zu immer höherer Objektivation begreiflich ist. Wir sehen daher z.B. im Festwerden der Knochen ein unverkennbares Analogon der Krystallisation, als welche ursprünglich den Kalk beherrschte, obgleich die Ossifikation nie auf Krystallisation zurückzuführen ist. Schwächer zeigt sich die Analogie im Festwerden des Fleisches. So auch ist die Mischung der Säfte im thierischen Körper und die Sekretion ein Analogon der chemischen Mischung und Abscheidung, sogar wirken die Gesetze dieser dabei noch fort, aber untergeordnet, sehr modifizirt, von einer höhern Idee überwältigt; […]“[204]
Wenn ein Autor auf Argumente von Schriftstellern vergangener Jahrzehnte zurückgreift, auf ihnen aufbaut und sie zitiert, so ist das bisweilen sehr einfach aufzuzeigen, und erfordert keine metaphysische Erklärung. Innerhalb der Vorstellung gibt es mit Blick auf kulturelle und biologische Evolution weniger voraussetzungsreiche Erklärungen. Schopenhauer betrachtet allerdings alles aus der Perspektive seines Systems. Der Analogie-Gedanke zwischen den vier Objektivationen ist so auch sehr weitreichend. Wie bereits im Abschnitt zum Mitleid erwähnt, sollte sich nach Schopenhauer auch ein Analogon zum Schmerz in der Pflanzenwelt und in der anorganischen Natur wiederfinden:
„Denn das Medium des Schmerzes ist die Vorstellung, als welche erst das Bewußtseyn zu Wege bringt, ohne welches kein Schmerz denkbar. Ein[en] Beweis davon giebt unser eigner Organismus: was nicht zum Gehirn, dem Sitz der Vorstellung gelangt, bleibt unbewußt, vom Vorgang der Verdauung und Sekretion erfahren wir nichts, weil das Centrum der ihnen vorstehenden Nerven das Gangliensystem ist. Nur wenn Störungen in ihnen so stark werden, daß sie durch mittelbar mit dem Gehirn kommunizirende Nerven dahin dringen, sind sie von Schmerz begleitet.
Daraus folgt, daß die vegetabilische und unorganische Natur nicht im eigentlichen Sinn leidet, noch sich freut. Und doch muß ein dumpfes Analogon daseyn: aber eben weil es völlig bewußtlos bleibt, ist es nicht jenen beizuzählen, noch nach ihnen zu benennen.“[205]
Schopenhauer beschreibt viele Naturbeobachtungen in seinen Werken und findet in ihnen Bestätigungen seiner Willensmetaphysik:
„Denn ausgehend vom rein Empirischen, von den Bemerkungen unbefangener, den Faden ihrer Specialwissenschaft verfolgender Naturforscher, gelange ich hier unmittelbar zum eigentlichen Kern meiner Metaphysik, weise die Berührungspunkte dieser mit den Naturwissenschaften nach und liefere so gewissermaaßen die Rechnungsprobe zu meinem Fundamentaldogma, welches eben dadurch sowohl seine nähere und speciellere Begründung erhält, als auch deutlicher, faßlicher und genauer, als irgendwo, in das Verständniß tritt.“[206]
Er beschreibt, wie harmonisch in jeder Tierart Wesen (Psychologie) und Organismus (Physiologie) zusammenpassen und sieht darin die Bestätigung, dass das Wollen (Wille) sich im Leib (Vorstellung) objektiviert hat.
„Denn was ich vom Menschen gezeigt habe, gilt auch vom Thiere: auch des Thieres Leib ist der objektivirte, in die Vorstellung getretene Wille des Thiers. Wie der Wille jedes Thiers ist, so ist sein Leib. Die Gestalt und Beschaffenheit jedes Thiers ist durchweg nur das Abbild der Art seines Wollens, der sichtbare Ausdruck der Willensbestrebungen, die seinen Karakter ausmachen: diesen ist die ganze Organisation genau angemessen; und von der Verschiedenheit der Karaktere der Thierspecies ist die Verschiedenheit ihrer Gestalten das bloße Bild. Die reißenden, auf Kampf und Raub gerichteten Thiere, Löwen, Tiger, Hyänen, Wölfe stehn da mit furchtbaren Angriffswaffen, schrecklichen Zähnen und Gebiß, gewaltigen Klauen und Krallen, sehr starken Muskeln. Sagt nicht das Gebiß des Haifisches, die Kralle des Adlers, der Rachen des Krokodills schon aus, was sie wollen und wozu sie hergekommen? – Nun hingegen die furchtsamen Thiere, deren Gesinnung nicht ist ihr Heil im Kampfe zu suchen, sondern vielmehr in der Flucht, die sind unbewaffnet gekommen, aber mit schnellen Füßen und leichtem Körper, die Hirsche, Rehe, Hasen, die Gazellen und Gemsen und alle die unzähligen harmlosen Wesen, die nicht andre fressen, aber wohl gefressen werden können: das furchtsamste v[on] allen, der Hase, mit langen Ohren, um feiner zu horchen. – Andre, die auch niemand fressen, folglich nicht angreifen wollen, aber zur Noth sich ihrer Haut zu wehren gedenken, die haben weder Klauen, noch Krallen und Gebiß, aber Vertheidigungswaffen, Hörner und Huf: die Stiere, die Widder und Steinböcke, die Pferde, die sich im Nothfall wenn Wölfe dasind alle auf einen Haufen mit den Köpfen zusammenstellen und nun hinten ausschlagen und so die Wölfe abwehren. Andre haben sich zur passivesten Vertheidigungsart, eine Art Festung mitgebracht: Armadille, Schuppenthiere, Schildkröten, Igel, Stachelschweine, Schnecken, Muscheln: der Tintenfisch Sepia, hat zur Vertheidigung seine Tinte mitgebracht. […] Und nun nicht bloß in Hinsicht auf Angriff und Vertheidigung, sondern durchweg nach den besondern zahllosen Modifikationen des Strebens und der Lebensweise und natürlicher Absicht eines Jeden ist auch sein Leib besonders modifizirt: daher die zahllosen Gestalten. Wo aber läßt sich, bei irgend einem Thier, ein Widerspruch auffinden zwischen seinem Streben, seinem Willen und seiner Organisation? Kein furchtsames Thier ist mit Waffen versehn und kein freches, streitbares Thier ist daron. Immer ist zwischen der Gestalt und dem Willen die vollkommenste Harmonie: dies eben bestätigt meinen Satz, daß Leib und Wille Eins sind; das Ursprüngliche und Erste der Wille; er selbst aber, sofern er sich objektivirt, Vorstellung wird, heißt Leib.“[207]
Wenn Schopenhauer aus psychologischen und physiologischen Merkmalen, die zusammenzupassen scheinen, metaphysische Schlussfolgerungen zieht (oder wenigstens als Bestätigung einer metaphysischen Spekulation sieht), ist das nicht überraschend. So hat Schopenhauer bereits für die Leib-Wille-Identität argumentiert, wohlwissend, dass sie nicht belegbar ist.
Naturwissenschaftliche Bestätigungen?
Mit dem 1836 erschienenen Buch Ueber den Willen in der Natur möchte Schopenhauer zeigen, dass seine Willensmetaphysik durch die neuesten naturwissenschaftlichen Entdeckungen seiner Zeit bestätigt wird.[208] Mit etwas Wohlwollen sollte man davon ausgehen, dass Schopenhauer seine Philosophie wenigstens als eine gute Deutung dieser naturwissenschaftlichen Beobachtungen sieht. Wollte er nur zeigen, dass sie nur nicht im Widerspruch zu diesen steht, wäre sie austauschbar. Dies streitet er ab:
„Meine Metaphysik bewährt sich dadurch als die einzige, welche wirklich einen gemeinschaftlichen Gränzpunkt mit den physischen Wissenschaften hat, einen Punkt, bis zu welchem diese aus eigenen Mitteln ihr entgegenkommen […]“[209]
Wollte er hingegen zeigen, dass die Erkenntnisse seine zentrale These belegt, würde er sich widersprechen, da das Ding an sich nicht objektiv erkennbar ist.[210] Dabei verweist Morgenstern darauf, dass Schopenhauer keine Bestätigung im naturwissenschaftlichen Sinne sucht, sondern dass man Metaphysik als eine als interpretatorische Ergänzung verstehen muss.[211]
Daraus ist zu schließen, dass Schopenhauer seine Willensmetaphysik als kompatible Ergänzung oder als Deutung sieht. Dabei ist entscheidend, was dieser „gemeinschaftliche Gränzpunkt“ ist, wodurch seine Philosophie sich von anderen unterscheidet. Ist es bloß die Nichtüberschreitung einer methodischen oder sachlichen Grenze zwischen Philosophie und Naturwissenschaften? Oder nähern sich nach Schopenhauer die Naturwissenschaften seiner Philosophie an?[212]
Zum einen beschreibt er die Grenzen der Naturwissenschaften, nämlich die Metaphysik:
„Die Physik nämlich, also Naturwissenschaft überhaupt, muß, indem sie ihre eigenen Wege verfolgt, in allen ihren Zweigen, zuletzt auf einen Punkt kommen, bei dem ihre Erklärungen zu Ende sind: dieser eben ist das Metaphysische, welches sie nur als ihre Gränze, darüber sie nicht hinaus kann, wahrnimmt, dabei stehn bleibt und nunmehr ihren Gegenstand der Metaphysik überläßt.“[213]
Zum einen stellt Schopenhauer die gemeinsame Suche nach der Wahrheit von Philosophie und Naturwissenschaften dar:
„da muß doch wahrlich den beiderseitigen verschiedenartigen Forschern zu Muthe werden wie den Bergleuten, welche, im Schooße der Erde, zwei Stollen, von zwei weit von einander entfernten Punkten aus, gegen einander führen und, nachdem sie beiderseits lange, im unterirdischen Dunkel, auf Kompaß und Libelle allein vertrauend, gearbeitet haben, endlich die lang ersehnte Freude erleben, die gegenseitigen Hammerschläge zu vernehmen. Denn jene Forscher erkennen jetzt, daß sie den so lange vergeblich gesuchten Berührungspunkt zwischen Physik und Metaphysik, die, wie Himmel und Erde, nie zusammenstoßen wollten, erreicht haben, die Versöhnung beider Wissenschaften eingeleitet und ihr Verknüpfungspunkt gefunden ist.“[214]
Als Bestätigungen für seine Metaphysik sieht Schopenhauer beispielsweise die Annahme einiger zeitgenössischen Naturwissenschaftlern von einem bewusstlosen Willen:[215]
„In seinen beiden neuesten Schriften: »Erfahrungen über die Anwendung der Kälte in Krankheiten«, Berlin 1833, und »Nosologie und Therapie der Kachexien« 1834, sehen wir ihn auf die ausdrücklichste, ja, auffallendeste Weise, als die Urquelle aller Lebensfunctionen einen bewußtlosen Willen aufstellen, aus diesem alle Vorgänge im Getriebe des Organismus, sowohl bei krankem, als bei gesundem Zustande, ableiten und ihn als das primum mobile des Lebens darstellen.“[216]
Als Bestätigung von Schopenhauers Philosophie durch die Naturwissenschaft könnte man Schopenhauers Plagiatsvorwürfe gegen Ärzte betrachten: Dem ordentlichen öffentlichen Professor Wiener Anton Rosas warf Schopenhauer vor, in seinem Handbuch der Augenheilkunde einige Seiten aus Schopenhauers Buch Über das Sehn und die Farben abgeschrieben zu haben.[217] Schopenhauer wirft auch dem dänischen Arztes J.D. Brandi vor, plagiiert zu haben.[218] Dieser habe in jedem Lebewesen einen Selbsterhaltungswillen, der stets nach Befriedigung strebt gesehen,[219] und erinnert damit an Schopenhauers Willensmetaphysik. Allerdings sei nicht nur Schopenhauer unerwähnt geblieben, sondern auch seine Aussagen ungestützt.[220]
Besonders Ausführungen über einen unbewussten Willen scheinen Schopenhauers System dienlich zu sein. Wie bereits in der Darstellung der Objektivationsstufen und der sie bestimmenden Ursachen gezeigt, gibt es bei ihm nur zwei Ursachen mit Bewusstsein; nämlich die anschauliche und die abstrakte Motivation. Kausalität ohne Bewusstsein in den Körperfunktionen kann Schopenhauer dem unbewusst agierenden Willen zuordnen.[221]
„Aus meinem Satze, daß Kants »Ding an sich«, oder das letzte Substrat jeder Erscheinung, der Wille sei, hatte ich nun aber nicht allein abgeleitet, daß auch in allen innern unbewußten Funktionen des Organismus der Wille das Agens sei; sondern ebenfalls, daß dieser organische Leib selbst nichts Anderes sei, als der in die Vorstellung getretene Wille, der in der Erkenntnißform des Raums angeschaute Wille selbst. Demnach hatte ich gesagt, daß, wie jeder einzelne momentane Willensakt sofort, unmittelbar und unausbleiblich sich in der äußern Anschauung des Leibes als eine Aktion desselben darstellt; so müsse auch das Gesammtwollen jedes Thieres, der Inbegriff aller seiner Bestrebungen, sein getreues Abbild haben an dem ganzen Leibe selbst, an der Beschaffenheit seines Organismus, und zwischen den Zwecken seines Willens überhaupt und den Mitteln zur Erreichung derselben, die seine Organisation ihm darbietet, müsse die allergenaueste Uebereinstimmung seyn. Oder kurz: der Gesammtcharakter seines Wollens müsse zur Gestalt und Beschaffenheit seines Leibes in eben dem Verhältnisse stehn, wie der einzelne Willensakt zur einzelnen ihn ausführenden Leibesaktion. – Auch dieses haben, in neuerer Zeit, denkende Zootomen und Physiologen, ihrerseits und unabhängig von meiner Lehre, als Thatsache erkannt und demnach a posteriori bestätigt: ihre Aussprüche darüber legen auch hier das Zeugniß der Natur für die Wahrheit meiner Lehre ab.“[222]
Zu der bereits im Abschnitt zum Analogon besprochenen von Schopenhauer als Bestätigung wahrgenommenen Übereinstimmung zwischen Charakter und Physiologie (und „Angemessenheit der Organisation jedes Thiers zu seiner Lebensweise“[223]) kommen also noch unbewusste organische Prozesse hinzu, die er im Sinne seiner Philosophie als Wille deutet. Hierbei ist der metaphysische vom individuellen Willen in der Vorstellung schwierig zu unterscheiden, da dieser für jenen namensgebend ist. Der unbewusst ist nicht nur der metaphysische Wille, sondern auch der individuelle Wille in der Vorstellung äußert sich in einigen Funktionen des Körpers unbewusst. So wie Schopenhauer einer Pflanze kein Bewusstsein einräumt,[224] sind auch Tiere (inkl. Menschlicher Tiere) nicht durch und durch ihrer selbst bewusst, da sie nach Schopenhauer von unteren Stufen ein Analogon in sich aufnehmen.[225]
Besondere Aufmerksamkeit schenkt Schopenhauer dem Nachweis der Erkenntnis als Gehirnfunktion. Schopenhauer trennt Wille und Erkenntnis voneinander und sieht in den naturwissenschaftlichen Arbeiten seiner Zeit den Nachweis des Intellekts als Gehirnfunktion. Für den Willen als der Physiologie ominöse Kraft bleibt damit eine vom Intellekt getrennte und ihm primäre Stellung übrig.[226]
„Die wahre Physiologie, auf ihrer Höhe, weist das Geistige im Menschen (die Erkenntniß) als Produkt seines Physischen nach; und das hat, wie kein Andrer, Cabanis geleistet: aber die wahre Metaphysik belehrt uns, daß dieses Physische selbst bloßes Produkt, oder vielmehr Erscheinung, eines Geistigen (des Willens) sei, ja, daß die Materie selbst durch die Vorstellung bedingt sei, in welcher allein sie existirt. Das Anschauen und Denken wird immer mehr aus dem Organismus erklärt werden, nie aber das Wollen, sondern umgekehrt, aus diesem der Organismus; wie ich unter der folgenden Rubrik nachweise. Ich setze also erstlich den Willen, als Ding an sich, völlig Ursprüngliches; zweitens seine bloße Sichtbarkeit, Objektivation, den Leib; und drittens die Erkenntniß, als bloße Funktion eines Theils dieses Leibes. Dieser Theil selbst ist das objektivirte (Vorstellung gewordene) Erkennenwollen, indem der Wille, zu seinen Zwecken, der Erkenntniß bedarf.“[227]
Neben den Erkenntnissen über Tiere sah Schopenhauer auch in den seinerzeit neuesten Erkenntnissen über Pflanzen Bestätigungen seiner Philosophie:
„Ueber die Erscheinung des Willens in Pflanzen rühren die Bestätigungen, welche ich anzuführen habe, hauptsächlich von Franzosen her; welche Nation eine entschieden empirische Richtung hat und nicht gern einen Schritt über das unmittelbar Gegebene hinausgeht.“[228]
Was Schopenhauer mit Bezug auf Pflanzen anführt, sind Willensäußerungen, die er in naturwissenschaftlichen Beschreibungen, bspw. über das Wachstum, sieht. So wie Tiere bewusst Ausschau halten nach Nahrung, so scheinen sich Pflanzen auch bewusst zu orientieren.[229] Schopenhauer schreibt dabei Pflanzen kein Bewusstsein zu, sondern ein Analogon auf niedriger Stufe, d.h. in einer geringeren Ausprägung. Sie reagieren, wie bereits im Abschnitt über die Objektivationsstufen betrachtet, nicht auf Motive (mit Bewusstsein), sondern auf Reize. Sie streben in die Richtung, aus der Reize gute Bedingungen zum Wachsen und Gedeihen versprechen: Pflanzen scheinen auf Biegen und Brechen günstigen Bedingungen entgegenzustreben und dafür auch kopfüber zu wachsen oder Blätter für Licht und Luft zu drehen. Dies veranlasste Botaniker, so Schopenhauer, sich zu fragen, ob dies ohne Bewusstsein vorginge, und bei ihnen von einer Art von Willen auszugehen.[230] Schopenhauer jedenfalls ging bereits in seinem Hauptwerk davon aus.
Auch in der Physik sieht Schopenhauer Bestätigungen seiner Lehre. Beispielsweise beschreibt Schopenhauer, dass empirische Methoden bei Naturkräften an ihre Grenzen stießen und sein metaphysischer Wille sich einsetzen ließe:
„Die flüssige Materie macht, durch die vollkommene Verschiebbarkeit aller ihrer Theile, die unmittelbare Aeußerung der Schwere in jedem derselben augenfälliger, als die feste es kann. Daher, um jenes Apperçu's, welches die wahre Quelle des Herschelschen Ausspruchs ist, theilhaft zu werden, betrachte man aufmerksam den gewaltsamen Fall eines Strohms über Felsenmassen, und frage sich, ob dieses so entschiedene Streben, dieses Toben, ohne eine Kraftanstrengung vor sich gehen kann, und ob eine Kraftanstrengung ohne Willen sich denken läßt. Und eben so überall, wo wir eines ursprünglich Bewegten, einer unvermittelten, ersten Kraft inne werden, sind wir genöthigt, ihr inneres Wesen als Willen zu denken. - So viel steht fest, daß hier Herschel, wie alle im Obigen von mir angeführten Empiriker so verschiedener Fächer, in seiner Untersuchung an die Gränze geführt war, wo das Physische nur noch das Metaphysische hinter sich hat, welches ihm Stillstand gebot, und daß eben auch er, wie sie alle, jenseit der Gränze nur noch Willen sehn konnte.“[231]
Schopenhauer meinte demnach, einen Grenzstein, gebe es nicht, für Philosophie und Naturwissenschaft gemeinsam, sondern lediglich für die Naturwissenschaft, die nicht aus den Erfahrungen Deutungen ableitet, sondern wohl weniger spekulativ ist. Dieser Grenzstein scheint für Schopenhauer nicht zu gelten, von keiner Seite, da er, wie er stets betont, seine Philosophie auf der Erfahrung aufbaut. Wenn Schopenhauers Metaphysik eine Deutung oder Interpretation der Erfahrung ist und dadurch die Naturwissenschaften ergänzt, dann ist die Bestätigung lediglich, dass keine Inkonsistenz oder sogar Kohärenz vorliegt.
Linguistik
Wesentlich vorsichtiger formuliert Schopenhauer, welche Phänomene verschiedener Sprachen,[232] für seine Willensmetaphysik sprechen:
„Die Sprache also, dieser unmittelbarste Abdruck unsrer Gedanken, giebt Anzeige, daß wir genöthigt sind, jeden innern Trieb als ein Wollen zu denken; aber keineswegs legt sie den Dingen auch Erkenntniß bei. Die vielleicht ausnahmslose Uebereinstimmung der Sprachen in diesem Punkt bezeugt, daß es kein bloßer Tropus sei, sondern daß ein tiefwurzelndes Gefühl vom Wesen der Dinge hier den Ausdruck bestimmt.“[233]
Unter den sprachlichen Phänomenen nennt Schopenhauer die Bildung des Will-Future im Englischen, in der mit dem Hilfsverb „will“ ein Wollen hinter jedem Wirken zum Ausdruck gebracht würde.[234]
Auch im Deutschen findet Schopenhauer einige Beispiele,[235] für die eine Aussage herhalten kann, wie man sie regelmäßig samstagabends in der Sportschau hören kann: „Der Ball will einfach nicht ins Tor.“ Oder aus dem Chemieunterricht mit Blick auf die Reaktionsträgheit von Edelgasen: „Sie wollen die äußerste Schale voll haben.“
Diese Phänomene sprechen eher für ein unbewusstes sprachliches Anthropomorphisieren. Sie zeigen vermutlich bloß, dass wir geneigt sind, Dinge so zu beschreiben, wie wir uns beschreiben, und zeugen nicht unbedingt von einem „tiefwurzelnden Gefühl vom Wesen der Dinge“.
Animalischer Magnetismus
Als praktische Metaphysik und Bestätigung der Willensmetaphysik sieht Schopenhauer auch die Magie und den Animalischen Magnetismus, der heute zur Parapsychologie gezählt wird.[236]
„Sehn wir nun also den Willen, welchen ich als das Ding an sich, das allein Reale in allem Daseyn, den Kern der Natur, aufgestellt habe, vom menschlichen Individuo aus, im animalischen Magnetismus, und darüber hinaus, Dinge verrichten, welche nach der Kausalverbindung, d.h. dem Gesetz des Naturlaufs, nicht zu erklären sind, ja, dieses Gesetz gewissermaaßen aufheben und wirkliche actio in distans ausüben, mithin eine übernatürliche, d.i. metaphysische Herrschaft über die Natur an den Tag legen; – so wüßte ich nicht, welche thatsächlichere Bestätigung meiner Lehre noch zu verlangen bliebe.“[237]
Schopenhauer berichtet beispielsweise vom Hypnotisieren und meint, dass Individuationsprinzip der Vorstellung (Raum, Zeit, Kausalität) durchbrochen werden kann.[238] Martin Morgenstern sieht darin nicht nur eine Aufgeschlossenheit für das Okkulte, sondern auch eine gewisse Leichtgläubigkeit Schopenhauers.[239]
Dritter Teil: Unbelegbare kohärente Deutung?
Unbelegbar
Wenn Schopenhauer die Brücke zwischen Leib-Wille-Identität und Welt-Wille-Identität schlagen will, so trifft er auf ein großes und bereits von der Leib-Wille-Identität bekanntes Hindernis: In Schopenhauers Sprache bewegen wir uns im Geltungsbereich des Satzes vom zureichenden Grunde, wenn wir argumentieren (Satz vom zureichenden Grunde des Erkennens[240]) oder von der Kausalität sprechen (Satz vom zureichenden Grunde des Werdens[241]). Das Ding an sich bzw. der metaphysische Wille ist keine bloße Vorstellung, für die allein der Satz vom zureichenden Grunde gilt:
„Der Wille als Ding an sich ist von seiner Erscheinung gänzlich verschieden und völlig frei von allen Formen derselben […]“[242]
Und:
„Daß die anderen Objekte, als bloße Vorstellungen betrachtet, seinem Leibe gleich sind, d.h. wie dieser den (nur als Vorstellung selbst möglicherweise vorhandenen) Raum füllen, und auch wie dieser im Raume wirken, dies ist zwar beweisbar gewiß, aus dem für Vorstellungen a priori sichern Gesetz der Kausalität, welches keine Wirkung ohne Ursache zuläßt: aber, abgesehen davon, daß sich von der Wirkung nur auf eine Ursache überhaupt, nicht auf eine gleiche Ursache schließen läßt; so ist man hiemit immer noch im Gebiet der bloßen Vorstellung, für die allein das Gesetz der Kausalität gilt, und über welches hinaus es nie führen kann.“[243]
So auch im zweiten Band:
„Das Ding an sich kann, eben als solches, nur ganz unmittelbar ins Bewußtseyn kommen, nämlich dadurch, daß es selbst sich seiner bewußt wird: es objektiv erkennen wollen, heißt etwas Widersprechendes verlangen.“[244]
Nach Schopenhauer kann der metaphysische Wille (auch wenn er „ganz unmittelbar ins Bewusstseyn“ kommen kann) also nicht bewiesen werden. Dem schließt sich Juhos an und fügt hinzu, dass Schopenhauers metaphysische Sätze ebenso wenig belegbar wie widerlegbar sind, und nennt sie daher inhaltsleer.[245] Nach Juhos sollen sie „etwa so wie die ‚Sätze‘ eines lyrischen Gedichts, bloß eine psychologische, eine Erlebniswirkung ausüben“[246] und beinhalten keine Erkenntnis, sondern sollen Vorstellungen erzeugen. Besonders stark kritisiert Juhos Schopenhauer dafür, dass dieser nie Wahrheitsbedingungen für seine Thesen angebe:
„Ganz analog verhält es sich mit dem Satze Schopenhauers ‚die Welt ist meine Vorstellung‘. Wann wäre diese These falsch zu nennen? Etwa wenn die Welt auch nach meinem Tode fortbesteht? Oder nach dem Tode aller Menschen? Im Sinne Schopenhauers bestimmt nicht. Daß die Welt auch nach seinem Tode fortbestehen werde, erwähnt er öfters und zugleich damit das Schicksal, das seine Werke und Gedanken dann haben werden. Ebenso spricht er von der Existenz der Welt, bevor es noch Menschen gegeben hat und wenn es keine mehr geben wird. Es fällt ihm niemals ein, die Wahrheit seiner These von solchen Tatsachenfragen abhängig zu machen. Die These soll ‚wahr‘ sein, was immer geschehen mag, es sind keine Umstände denkbar, durch die sie widerlegt würde. Aber darum sagt sie nichts aus, ist keine Erkenntnis und kann ebensowenig wahr wie falsch sein.“[247]
Nicht nur den Satz „Die Welt ist meine Vorstellung“, sondern auch die andere Kernaussage von Schopenhauers Philosophie kritisiert Juhos. Diese ist, dass alle Objekte der Vorstellung Objektivation eines Willens sind. Nicht selten formuliert Schopenhauer, dass er diese nachgewiesen habe.
„[…] ich habe dagegen als den Kern aller Wesen Das nachgewiesen was in uns der Wille ist, der erst in der animalischen Natur mit einem Intellekt ausgerüstet auftritt.“[248]
Und:
„Die Theisten wollen eine Ausgleichung zwischen Dem, was Einer thut, und Dem, was er leidet: ich auch. Sie aber nehmen solche erst mittelst der Zeit und eines Richters und Vergelters an; ich hingegen unmittelbar; indem ich im Thäter und im Dulder das selbe Wesen nachweise.“[249]
Auch diesem Satz wirft Juhos vor, er enthalte keine Erkenntnisse und sei inhaltsleer. Er meint, dass Schopenhauer keine Umstände formuliert, unter denen dieser Satz als widerlegt gilt. Wenn man den Satz nicht widerlegen kann, hat er keinen Wert. Auch ohne „dumpfes Seinsgefühl“ des Subjekts wäre der Satz nicht widerlegt, da die unbelebte Natur dennoch Objektivation des Willens sei.[250]
„Wäre dies etwa der Fall, wenn wir nicht das dumpfe Seinsgefühl hätten, von dem Schopenhauer ausgeht, um durch ‚Analogieschlüsse‘ zu seiner allgemeinen Deutung zu gelangen? Keineswegs, die tote Natur, die kein Seinsgefühl hat, soll ja in gleichem Sinne Objektivation des ‚Willens‘ sein wie die belebte.“[251]
Die Argumentation von Juhos bezieht sich auf „dumpfes Seinsgefühl“. Von diesem Gefühl ausgehend vollziehe Schopenhauer einen „Analogieschluss“ hin zu einer allgemeinen Deutung, wobei er dieses Gefühl nur der organischen Natur zuschreibe und nicht der anorganischen Natur. Hätte das Subjekt dieses Gefühl nicht, so Juhos, wäre nicht widerlegt, dass die anorganische Natur Objektivation des Willens sei. Leider nennt Juhos die Textstelle nicht, auf die er sich mit dem „dumpfen Seinsgefühl“ bezieht. Inhaltlich geht es um § 18 W I, nämlich die Leib-Wille-Identität. Wäre, Juhos folgend, Schopenhauers Metaphysik widerlegt, wenn man jene widerlegen könnte? Ja, da die Welt-Wille-Identität die Leib-Wille-Identität miteinschließt. Sie ist aber genauso wenig belegbar oder widerlegbar.
Dass Juhos zum Schluss kommt, die Welt-Wille-Identität wäre nicht widerlegt, liegt daran, dass er den sogenannten Analogieschluss falsch rekonstruiert. Außerdem gelangt er zu einem Widerspruch, wenn er das Subjekt mit der Aberkennung des „dumpfen Seinsgefühls“, das sich in den Paragraphen 18 f. nicht wiederfindet, zur toten Natur macht. Das Subjekt gehört bei Schopenhauer schließlich zur organischen Natur.
Juhos meint, dass Schopenhauer seine metaphysischen Behauptungen anschaulich und mythisch darstellt und dabei beim Leser Vorstellungen oder Gefühle erzeugt, die er dann als Beleg nutze. Schopenhauer verflechte Metaphysik mit der Beschreibung Tatsachen oder dem Bericht von Erlebnissen und schafft dabei lediglich einen neuen Erlebniszusammenhang. Dabei hat dieser einen psychologischen Wert:
„Aus dieser Darstellungsweise entspricht nicht bloß die Lebendigkeit der Metaphysik Schopenhauers, sondern der Leser gewinnt durch ihre Vermittlung eine Fülle neuer psychologischer Einblicke, es gehen ihm die Augen auf, er lernt sich und die Menschen besser kennen durch die Lektüre dieser Metaphysik.“[252]
Für Juhos ist Schopenhauers Metaphysik schließlich ohne Erkenntnisgehalt, den sie allerdings für sich beanspruche.[253] Ihr Wert liege eher in der kunstvollen Beschreibung psychologischer Einblicke und der mythischen Ausdeutung menschlicher Erlebnisse und Seelenzustände[254] und in neuen psychologischen Erkenntnissen,[255] wofür allerdings die einfache Sprache der Psychologie reiche.[256]
Dobrzański meint, Schopenhauer gehe mit dem Begriff „Wahrheit“ „salopp“ um. Eine Erkenntnis mit zureichendem Grund für sie, sei für ihn auch Wahrheit.[257] Dabei beruft Dobrzański sich auf die folgende Stelle im Hauptwerk:
„Wissen überhaupt heißt: solche Urtheile in der Gewalt seines Geistes zu willkürlicher Reproduktion haben, welche in irgend etwas außer ihnen ihren zureichenden Erkenntnißgrund haben, d.h. wahr sind.“[258]
Möglicherweise kann für Schopenhauer eine unbelegbare Aussage als wahr gelten, sofern außerhalb der Begriffe, also unmittelbar anschaulich (in der Erfahrung), etwas für sie spricht:
„Wissen also ist das abstrakte Bewußtseyn, das Fixirthaben in Begriffen der Vernunft, des auf andere Weise überhaupt Erkannten.“[259]
Falls also unbelegbare Aussagen eine Erfahrung (kohärent) deuten, können sie für wahr gehalten werden. Schließlich hat die anschauliche Erfahrung bei Schopenhauer einen besonderen Stellenwert. Wahres sei auch ohne Beweise und Schlüsse unmittelbar erkennbar:
„Es kann keine Wahrheit geben, die unbedingt allein durch Schlüsse herauszubringen wäre; sondern die Nothwendigkeit, sie bloß durch Schlüsse zu begründen, ist immer nur relativ, ja subjektiv. Da alle Beweise Schlüsse sind, so ist für eine neue Wahrheit nicht zuerst ein Beweis, sondern unmittelbare Evidenz zu suchen, und nur so lange es an dieser gebricht, der Beweis einstweilen aufzustellen. Durch und durch beweisbar kann keine Wissenschaft seyn; so wenig als ein Gebäude in der Luft stehn kann: alle ihre Beweise müssen auf ein Anschauliches und daher nicht mehr Beweisbares zurückführen. Denn die ganze Welt der Reflexion ruht und wurzelt auf der anschaulichen Welt. Alle letzte, d.h. ursprüngliche Evidenz, ist eine anschauliche: dies verräth schon das Wort. Demnach ist sie entweder eine empirische, oder aber auf die Anschauung a priori der Bedingungen möglicher Erfahrung gegründet: in beiden Fällen liefert sie daher nur immanente, nicht transscendente Erkenntniß. Jeder Begriff hat seinen Werth und sein Daseyn allein in der, wenn auch sehr vermittelten Beziehung auf eine anschauliche Vorstellung: was von den Begriffen gilt, gilt auch von den aus ihnen zusammengesetzten Urtheilen, und von den ganzen Wissenschaften. Daher muß es irgendwie möglich seyn, jede Wahrheit, die durch Schlüsse gefunden und durch Beweise mitgetheilt wird, auch ohne Beweise und Schlüsse unmittelbar zu erkennen.“[260]
Kohärenz
Schopenhauers sogenannter Analogieschluss sollte, wie Hallich meint, nicht isoliert betrachtet werden,[261] Schopenhauer sei sich im Klaren gewesen, keine zwingenden Argumente geliefert zu haben. „Es wäre also verfehlt anzunehmen, dass die §§ 17–19 die gesamte Begründungslast für die Willensmetaphysik tragen sollen.“[262] Auch mit Blick auf Birnbachers Ausführungen hinsichtlich des Kohärenzkriteriums,[263] kann die These gestärkt werden, dass Schopenhauer seine Willensmetaphysik nicht allein auf dem sog. Analogieschluss oder alternative Belegungsversuche aufbaut, sondern ein kohärentes Ganzes als Deutung anbieten wollte. Dieses kann ihm dann als belastbar oder gar Beleg gegolten haben. Dafür sprechen seine Bemerkungen über seine Philosophie:
„Deshalb auch habe ich über die Zusammenstimmung meiner Sätze stets außer Sorgen seyn können; sogar noch dann, wann einzelne derselben mir, wie bisweilen eine Zeit lang der Fall gewesen, unvereinbar schienen: denn die Uebereinstimmung fand sich nachher richtig von selbst ein, in dem Maaße, wie die Sätze vollzählig zusammenkamen; weil sie bei mir eben nichts Anderes ist, als die Uebereinstimmung der Realität mit sich selbst, die ja niemals fehlen kann. Dies ist Dem analog, daß wir bisweilen, wenn wir ein Gebäude zum ersten Mal und nur von Einer Seite erblicken, den Zusammenhang seiner Theile noch nicht verstehn, jedoch gewiß sind, daß er nicht fehlt und sich zeigen wird, sobald wir ganz herumgekommen. Diese Art der Zusammenstimmung aber ist, vermöge ihrer Ursprünglichkeit und weil sie unter beständiger Kontrole der Erfahrung steht, eine vollkommen sichere: hingegen jene abgeleitete, die der Syllogismus allein zu Wege bringt, kann leicht ein Mal falsch befunden werden; sobald nämlich irgend ein Glied der langen Kette unächt, locker befestigt, oder sonst fehlerhaft beschaffen ist. Dem entsprechend hat meine Philosophie einen breiten Boden, auf welchem Alles unmittelbar und daher sicher steht; während die andern Systeme hoch aufgeführten Thürmen gleichen: bricht hier eine Stütze, so stürzt Alles ein. – Alles hier Gesagte läßt sich in den Satz zusammenfassen, daß meine Philosophie auf dem analytischen, nicht auf dem synthetischen Wege entstanden und dargestellt ist.“[264]
Diesem Zitat sind hauptsächlich drei Punkte zu entnehmen: Erstens geht Schopenhauer natürlich davon aus, dass die Gesamtheit seiner philosophischen Aussagen ein kohärentes System ergeben. Dies ergibt dies daraus, dass er zweitens alle Sätze auf der Erfahrung und damit auf Beobachtungen, Deutungen, Induktionen und Analogien aufbaut. Drittens schätzt Schopenhauer eine rein deduktive Herangehensweise nicht. Auch daraus ergibt sich, dass der sogenannte Analogieschluss in Schopenhauers Augen nicht allein seine Willensmetaphysik begründet, sondern höchstens zur Begründung oder Plausibilität beiträgt.
Der Gedanke der Kohärenz findet sich bereits in der Vorrede zur ersten Auflage von Die Welt als Wille und Vorstellung:
„Ein System von Gedanken muß allemal einen architektonischen Zusammenhang haben, d.h. einen solchen, in welchem immer ein Theil den andern trägt, nicht aber dieser auch jenen, der Grundstein endlich alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu tragen. Hingegen ein einziger Gedanke muß, so umfassend er auch seyn mag, die vollkommenste Einheit bewahren. Läßt er dennoch, zum Behuf seiner Mittheilung, sich in Theile zerlegen; so muß doch wieder der Zusammenhang dieser Theile ein organischer, d.h. ein solcher seyn, wo jeder Theil ebenso sehr das Ganze erhält, als er vom Ganzen gehalten wird, keiner der erste und keiner der letzte ist, der ganze Gedanke durch jeden Theil an Deutlichkeit gewinnt und auch der kleinste Theil nicht völlig verstanden werden kann, ohne daß schon das Ganze vorher verstanden sei. – Ein Buch muß inzwischen eine erste und eine letzte Zeile haben und wird insofern einem Organismus allemal sehr unähnlich bleiben, so sehr diesem ähnlich auch immer sein Inhalt seyn mag: folglich werden Form und Stoff hier im Widerspruch stehen.
Es ergiebt sich von selbst, daß, unter solchen Umständen, zum Eindringen in den dargelegten Gedanken, kein anderer Rath ist, als das Buch zwei Mal zu lesen und zwar das erste Mal mit vieler Geduld, welche allein zu schöpfen ist aus dem freiwillig geschenkten Glauben, daß der Anfang das Ende beinahe so sehr voraussetze, als das Ende den Anfang, und eben so jeder frühere Theil den spätern beinahe so sehr, als dieser jenen.“[265]
Die Vorrede lässt Schopenhauers Texte wie ein Puzzle oder Mosaik erscheinen, das nur zusammengesetzt ein Bild ergibt. Nach dem Zusammensetzen könnte man dann, in diesem sprachlichen Bild bleibend, kein Einzelteil als wesentlich betrachten. Genauso könnte man meinen, für Schopenhauers Willensmetaphysik sei nicht ein Paragraph hinreichend, sondern bloß die Gesamtheit. Ihre Übereinstimmung und nicht konkrete Schlussketten sollen das Ganze tragen:
„Meine Sätze hingegen beruhen meistens nicht auf Schlußketten, sondern unmittelbar auf der anschaulichen Welt selbst, und die, in meinem Systeme, so sehr wie in irgend einem, vorhandene strenge Konsequenz ist in der Regel nicht eine auf bloß logischem Wege gewonnene; vielmehr ist es diejenige natürliche Uebereinstimmung der Sätze, welche unausbleiblich dadurch eintritt, daß ihnen sämmtlich dieselbe intuitive Erkenntniß, nämlich die anschauliche Auffassung des selben, nur successive von verschiedenen Seiten betrachteten Objekts, also der realen Welt, in allen ihren Phänomenen, unter Berücksichtigung des Bewußtseyns, darin sie sich darstellt, zum Grunde liegt.“[266]
Die Bedingungen dafür sind, dass Schopenhauers Philosophie tatsächlich innerhalb der Erfahrung bleibt und kohärent ist.
An der Kohärenz von Schopenhauers System gibt es einige Zweifel. Ein Problem wurde bereits im vorigen Abschnitt angesprochen. Das Ding an sich entzieht sich auch für Schopenhauer der Erkenntnis, dennoch formuliert er immer wieder, wie bereits erwähnt, sehr sicher, dass er Aussagen über den Willen belegt habe.
An Vorwürfen der Widersprüchlichkeit mangelt es nicht.[267] Beispielsweise wirft Eduard Zeller Schopenhauer schon 1873 „grobe und handgreifliche Widersprüche“[268] vor, darunter der sogenannte Zellersche Zirkel.[269] Die Vorstellung ist ein Produkt des Verstandes. Dieser ist eine Gehirnfunktion. Das Gehirn ist Teil des organischen Leibes, der erst in der Vorstellung erscheint.
„Denn der Wille ist dasjenige Wesen an sich, welches erst in der Vorstellung (jener bloßen Gehirnfunktion) sich als ein solcher organischer Leib darstellt: nur vermöge der Formen der Erkenntniß (oder Gehirnfunktion), also nur in der Vorstellung, ist der Leib eines Jeden ihm als ein Ausgedehntes, Gegliedertes, Organisches gegeben, nicht außerdem, nicht unmittelbar im Selbstbewußtseyn.“[270]
Schopenhauer versucht diese Spannung zwischen Idealismus und Materialismus aufzulösen. Das Gehirn kann, wie die Welt auch, als Wille und als Vorstellung betrachtet werden.
„Das Gehirn selbst ist, sofern es vorgestellt wird, – also im Bewußtseyn anderer Dinge, mithin sekundär, – selbst nur Vorstellung. An sich aber und sofern es vorstellt, ist es der Wille, weil dieser das reale Substrat der ganzen Erscheinung ist: sein Erkennenwollen objektivirt sich als Gehirn und dessen Funktionen.“[271]
Im Abschnitt über die vermeintlichen naturwissenschaftlichen Bestätigungen wurde diese Spannung zwischen Materialismus und Idealismus bereits angedeutet. In diesem Kontext versucht Schopenhauer an seiner idealistischen Grundansicht festzuhalten:[272]
„Diese Funktion nun aber bedingt wieder die ganze Welt als Vorstellung, mithin auch den Leib selbst, sofern er anschauliches Objekt ist, ja, die Materie überhaupt, als welche nur in der Vorstellung vorhanden ist. Denn eine objektive Welt, ohne ein Subjekt, in dessen Bewußtseyn sie dasteht, ist, wohlerwogen, etwas schlechthin Undenkbares. Die Erkenntniß und die Materie (Subjekt und Objekt) sind also nur relativ für einander da und machen die Erscheinung aus.“[273]
Schwierig ist außer den möglichen Widersprüchen die begriffliche Unterscheidung zwischen individuellem und metaphysischem Willen. Besonders in der Darstellung der Leib-Wille-Identität und im Abschnitt über den Willen in der Natur treten diese Schwierigkeiten auf. In jedem Fall dürften also zumindest Zweifel an der Kohärenz von Schopenhauers System bleiben.
Deutung
Darauf, dass Schopenhauer lediglich eine metaphysische Deutung der erfahrbaren Welt geliefert hat oder nur liefern wollte, gab es bereits einige Hinweise: Von einer Deutung beim Analogieschluss sprechen Dobrzański,[274] Juhos[275] und Welsen.[276] Auch beim Mitleid wird von einer „spekulativ-mythologische Deutung des Mitleids“[277] gesprochen. Und so verweist auch Morgenstein darauf, dass Schopenhauer in der Naturwissenschaft keine Bestätigung im naturwissenschaftlichen Sinne sucht, sondern dass man Metaphysik als eine als interpretatorische Ergänzung verstehen muss.[278]
Dobrzański beschreibt Schopenhauers philosophisches Projekt als „Daseinsdeutung mit prozessualem Charakter“[279] und stellt seine Methode als dreistufig dar: Die empirische Welt, bestehend aus der sinnlichen (außen) und mentalen Welt (innen) wird im ersten Schritt durch das Subjekt betrachtet. Das so gesammelte Erkenntnismaterial wird im zweiten Schritt gedeutet, sodass eine metaphysische Theorie aus der Deutung des Inhalts der immanenten Erfahrung des erkennenden Subjekts entsteht und damit die empirische Seite der Welt ergänzt. Im dritten Schritt, so Dobrzański, wird diese Deutung[280] zur Auslegung der dem Subjekt immanenten Welt genutzt.[281] Dies findet sich bei Schopenhauer in Kapitel 50 des Zweiten Bands von Die Welt als Wille und Vorstellung:
„Sie macht demnach keine Schlüsse auf das jenseit aller möglichen Erfahrung Vorhandene, sondern liefert bloß die Auslegung des in der Außenwelt und dem Selbstbewußtseyn Gegebenen, begnügt sich also damit, das Wesen der Welt, seinem innern Zusammenhange mit sich selbst nach, zu begreifen. Sie ist folglich immanent, im Kantischen Sinne des Worts. Eben deshalb aber läßt sie noch viele Fragen übrig, nämlich warum das thatsächlich Nachgewiesene so und nicht anders sei, u.s.w.“[282]
Schopenhauer spricht außerdem oft vom „Entziffern“. Die aus der subjektiven Erfahrung gedeutete Metaphysik kann nach Schopenhauer (wenn sie kohärent ist) zur Entzifferung der Erfahrung beitragen:
„Das Ganze der Erfahrung gleicht einer Geheimschrift, und die Philosophie der Entzifferung derselben, deren Richtigkeit sich durch den überall hervortretenden Zusammenhang bewährt. Wenn dieses Ganze nur tief genug gefaßt und an die äußere die innere Erfahrung geknüpft wird; so muß es aus sich selbst gedeutet, ausgelegt werden können.“[283]
Birnbacher spricht von einer „induktive Metaphysik“ und nennt dafür zwei von Schopenhauer postulierten Wahrheitskriterien:
„Die von Schopenhauer für die Metaphysik postulierten Wahrheitskriterien füllen das entstehende Bild einer induktiven Metaphysik folgerichtig weiter aus. Da die Metaphysik die Empirie erklären soll, müssen sich auch ihre Wahrheitskriterien letztlich auf die Erfahrung beziehen. Schopenhauer gibt im wesentlichen zwei Kriterien an, ein Kohärenz- und ein Integrationskriterium: Erstens bemißt sich die Wahrheit einer metaphysischen Aussage danach, inwieweit unsere Erfahrungen zu ihr „passen“, inwieweit es ihr gelingt, das Rätselhafte, Erklärungsbedürftige in ihnen aufzuklären. […] Zweitens bemißt sich die Wahrheit einer metaphysischen Aussage danach, inwieweit es ihr gelingt, scheinbar disparate und „widersprüchliche“ Phänomene unter einheitliche Erklärungsprinzipien zu bringen. […] Insgesamt läßt Schopenhauer für die Metaphysik damit keine anderen Wahrheitskriterien gelten, als sie auch für höherstufige wissenschaftliche Theoriebildungen gelten.“[284]
Metaphysik im Sinne Schopenhauers hat die Aufgabe, sich an der Erfahrung zu orientieren, sie auszulegen und ein kohärentes Aussagensystem zu entwerfen.[285] Demnach muss der Analogieschluss nicht allein herhalten als argumentative Stütze für Schopenhauers Metaphysik. Der Analogieschluss ist lediglich ein an der Erfahrung angelehnter Baustein des (im Idealfall) kohärenten Ganzen.
Wie Birnbacher darstellt,[286] sieht Schopenhauer seine eigene Philosophie als eine immanente Deutung ohne Erklärungsanspruch. Er beschreibt sie so:
„Sie macht demnach keine Schlüsse auf das jenseit aller möglichen Erfahrung Vorhandene, sondern liefert bloß die Auslegung des in der Außenwelt und dem Selbstbewußtseyn Gegebenen, begnügt sich also damit, das Wesen der Welt, seinem innern Zusammenhange mit sich selbst nach, zu begreifen. Sie ist folglich immanent, im Kantischen Sinne des Worts. Eben deshalb aber läßt sie noch viele Fragen übrig, nämlich warum das thatsächlich Nachgewiesene so und nicht anders sei, u.s.w.“[287]
Dieser Beschreibung wird Schopenhauers Philosophie, so Birnbacher, nicht gerecht. Sie erhebe einen deutlich größeren Wahrheitsanspruch als eine bloße Deutung.[288] Auch nach Malter hat Schopenhauer nicht nur Phänomene der realen Welt gedeutet:
„Sein Bewußtsein, philosophisch das Rätsel der Leidensexistenz gelöst zu haben, ist stark und unangefochten von Skepsis. Gleichwohl läßt sie sich angesichts des allenthalben auftauchenden Unerklärbaren nicht aufhalten: was ist dies für eine Rätselauflösung, bei der die Hauptsachen als pure Fakten zu akzeptieren sind […]“[289]
Fazit
Das Ziel dieser Arbeit war es, zu zeigen, wie Schopenhauer für die Welt-Wille-Identität argumentiert, wie er „nachgewiesen“ hat, dass der Kern aller Wesen der Wille als Ding an sich ist. Dazu war der Analogieschluss zentral, da Schopenhauer explizit einen argumentativen Weg zu seinem Ziel vorschlägt.
Der erste Teil hat gezeigt, dass es sich bei Schopenhauers Analogieschluss nicht um einen Analogieschluss handelt. Ein Analogieschluss geht von gemeinsamen Eigenschaften von Objekten aus und schließt von ihnen darauf, dass über diese Gemeinsamkeit hinaus noch eine weitere besteht. Schopenhauer beurteilt die anderen Objekte schlicht analog zu seinem Leib. Er stellt zwar die eine gemeinsame Eigenschaft (Objektsein) auf und fragt, ob über diese Gemeinsamkeit hinaus diese Objekte gemeinsame Eigenschaften teilen, aber er setzt dies bereits voraus. Einen Analogieschluss bräuchte er nämlich nicht, da er sich, ausgehend von der nicht belegbaren Leib-Wille-Identität, dafür entscheidet, dass die anderen Objekte der Vorstellung auch etwas „an sich“ sein müssten. Mit dieser Ablehnung des sogenannten theoretischen Egoismus hat er nichts bewiesen, aber kann sein Projekt weiterführen. Würde er das nicht machen, könnte er seine Untersuchung nicht fortführen, es gebe nur ein Subjekt.
Auch die Schopenhauer-Literatur geht überwiegend nicht von einem Analogieschluss aus. Stattdessen wird oftmals dessen Nutzen oder Ernsthaftigkeit infrage gestellt.
Wie die Arbeit gezeigt hat, wäre ein Analogieschluss außerdem wenig hilfreich. Ein solider Analogieschluss beruht darauf, dass viele und unterschiedliche Gemeinsamkeiten zwischen Objekten genannt werden. Schließlich will man gerade die etablierte Ähnlichkeit zwischen zwei Objekten argumentativ nutzen, um von einer um eine Eigenschaft größere Ähnlichkeit zu überzeugen. Dann wäre es, wie beim Problem des Fremdpsychischen üblich, eine Möglichkeit, ausgehend von äußerlich beobachtbaren Ähnlichkeiten zwischen anderen Menschen und sich selbst auf innerliche Eigenschaften zu schließen, die man nur bei sich selbst beobachten kann. Da Schopenhauer allerdings den Willen als Ding an sich bei allen Objekten der Vorstellung „nachweisen“ will, wäre nur ein sehr schwacher Analogieschluss möglich.
Die Schopenhauer-Forschung geht überwiegend nicht nur davon aus, dass der Analogieschluss keiner echter Analogieschluss ist, sondern geht außerdem davon aus, dass diese Textstelle nicht allein für Schopenhauers Willensmetaphysik argumentieren soll. Überwiegend wird dennoch die Ansicht vertreten, dass diese Stelle eine zentrale, von großer Bedeutung für seine Metaphysik ist. Selbst wenn die Willensmetaphysik nicht allein durch den sogenannten Analogieschluss getragen wird, so ist er dennoch die erste Anlaufstelle, wenn man Schopenhauers Argumenten für diese Metaphysik nachspürt.
Der zweite Teil der Arbeit hat also die Funktion, alternative Argumente zu finden, darzustellen und zu prüfen. Welche Argumente stützen das System implizit oder explizit noch. Am stärksten scheint das Mitleid noch geeignet zu sein. Explizit formuliert Schopenhauer, dass Menschen ganz unmittelbar ohne Schlüsse den Kern von Schopenhauers Philosophie sehen, also den einen Willen als Ding an sich aller Objekte. Die Mitleidserfahrung bricht das Individuationsprinzip auf.
Das Mitleid weist allerdings einige Probleme auf. Erstens folgt aus der Mitleidserfahrung nicht notwendigerweise eine sichere Erkenntnis. Es handelt sich um ein Gefühl, das möglicherweise handlungsmotivierend ist, aber nicht unbedingt in Schopenhauers Sinne gedeutet wird.
Zweitens kann kaum einem Menschen die Mitleidsfähigkeit abgesprochen werden. Wenn daher jeder diese Erfahrung macht und dadurch notwendigerweise positiv verändert wird und dann das Wohl und Wehe anderer Lebewesen wenigstens mitberücksichtigt, ist die Existenz moralisch schlechten Handelns nicht zu erklären.
Drittens scheint die Reichweite des Mitleids vom Nahen und Ähnlichen auszugehen und bei den Fernsten und Unähnlichsten schwächer zu werden. Biologisch nahen Wesen kommt wohl mehr Mitgefühl zugute als entfernt verwandten. Insofern würden metaphysische Annahmen aufgrund einer Mitleidserfahrung sich eher auf biologisch nah verwandte ausweiten als auf ferner Verwandte. Das aufgrund einer Mitleidserfahrung von einem metaphysischen Kern aller Objekte ausgegangen wird, insbesondere auch anorganische, scheint daher unplausibel.
Viertens ist die menschliche Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, nicht zuverlässig an tatsächlich empfundenes Leid gekoppelt. Mitmenschen können leiden, ohne bei uns Mitleid auszulösen. Auch können wir Mitleid mit Menschen empfinden, die nicht leiden. Wenn das Mitleid nicht zuverlässig Aussagen über andere Wesen liefert, können auch metaphysische Aussagen dadurch nicht zuverlässig gestützt werden.
Zudem stellt sich die Frage, wie innerhalb der Erfahrung die Bedingungen der Erfahrung dem Subjekt aufgelöst werden können. Wie, wenn nicht als Erscheinung, können ihm andere Menschen erscheinen?
Möglicherweise ist das Mitleid insofern eine Stütze, als dass eine solche Erfahrung metaphysisch gedeutet wird.
Im zweiten Teil wurde der Fokus neben dem Mitleid auch auf Naturbeobachtungen und fragliche Bestätigungen von Schopenhauers Willensmetaphysik durch die Naturwissenschaft gelegt. Schopenhauer sieht eine metaphysische Einheit in der Verwandtschaft von Eigenschaften der Objektarten. Die Objektivationsstufen zeichnen sich dadurch aus, dass sie analogische Beziehungen haben, so Schopenhauer. In unterschiedlichen Formen findet man Eigenschaften von Pflanzen in Tieren und tierische Eigenschaften in Menschen. Dass dies nur eine metaphysische Deutung und kein fester Beleg ist, scheint Schopenhauer auch klar zu sein. Er liefert weitere Beobachtungen und Belege dieser Art, um seine Willensmetaphysik plausibel zu machen. Der metaphysische Charakter und die in der Erscheinung zu findende Physiologie von Lebewesen seien aufeinander abgestimmt, was dadurch in Schopenhauers Philosophie erklärt wird, dass der Leib (Physiologie) die Objektivation dieses Charakters ist.
Die naturwissenschaftlichen Bestätigungen sieht Schopenhauer darin, dass die zeitgenössischen Veröffentlichungen in den unterschiedlichen Disziplinen auf unerklärliche Kräfte verweisen. Wenn Physik oder Biologie in der Empirie verbleibend mit ihren Erklärungen nicht weiterkommen, scheint Schopenhauer seine Willensmetaphysik als Gegenstück zu sehen, die ihrerseits auch eine Grenze nicht überschreitet. Die Naturwissenschaft und die Philosophie Schopenhauers ergänzten sich demnach. Beispiele findet Schopenhauer in Schilderungen von Ärzten über einen unbewussten Willen, oder in der Übereinstimmung von Wesen und Physiologie. Auch sieht er sich bestätigt dadurch, dass das Gehirn als Sitz des Intellekts beschrieben wird, während für den unbewussten Willen im Körper kein Ort genannt wird. Dies scheint damit übereinzustimmen, dass der Wille metaphysisch und primärer Natur ist, während der Intellekt in der Vorstellung dem Willen nachgeordnet ist.
Ebenso scheinen die Beschreibungen vom Wachstum von Pflanzen Schopenhauers Idee vom Willen zu bestätigen. Schopenhauer sieht einen unbewussten Willen in den unterschiedlichen Objektivationsstufen mit unterschiedlichen Graden am Werk.
Die zeitgenössische Physik bleibt, so Schopenhauer, am Grenzstein der Metaphysik stehen, wenn sie auf Naturkräfte verweist.
Dieser gemeinsame Grenzstein scheint allerdings kein gemeinsamer zu sein, sondern nur für die Naturwissenschaft zu gelten, da Schopenhauer über die Beobachtungen metaphysisch deutet und mit diesen Deutungen die Grenze wieder überschreitet.
Am wenigsten plausibel sind aus heutiger Sicht Schopenhauers Darstellungen zur Magie, in denen er sich zudem zu widersprechen scheint. Wie auch beim Mitleid ist hier die Frage aufzuwerfen, wie in der Vorstellung durch Magie das Individuationsprinzip aufgehoben werden kann.
Als schwachen Beleg scheint Schopenhauer seine Ausführungen zur Sprache zu sehen. Hier formuliert Schopenhauer vorsichtig, dass in unserer Sprache unser Denken Ausdruck findet, und wir von seinem System gewissermaßen überzeugt sein müssten, da wir das Wort „Wollen“ so gebrauchen, als steckte hinter allen Objektarten ein Wille.
Der dritte Teil beginnt mit einer Erinnerung daran, dass Schopenhauer einen Beleg im engeren Sinne zu liefern nicht imstande ist. Zwar formuliert er mindestens so häufig, dass er seine Willensmetaphysik belegt habe, aber dies ist scheinbar kein Beleg mit großem Anspruch. Das Ding an sich, bei Schopenhauer Wille genannt, ist auch für Schopenhauer nicht objektiv erkennbar.
Der dritte Teil stellt sich außerdem die Frage, wie diesen ganzen Ausführungen bzw. die ihnen zugrunde liegenden Schopenhauerschen Abschnitte zusammenhängen. Schopenhauer spricht vielfach davon, dass sein System ein organisches sei und alles zusammenhinge und nicht allein zum Verständnis reiche. Möglicherweise soll weder der sogenannte Analogieschluss noch irgendeine andere Stelle seiner Werke für sich alleinstehen, sondern alles kohärent sein und dadurch an Überzeugungskraft gewinnen. Allerdings gibt es Zweifel daran, dass Schopenhauers Philosophie widerspruchsfrei ist.
Schließlich wird im dritten Teil Schopenhauers Willensmetaphysik als eine Deutung verstanden. Wenn man bloß von einer Deutung ausgeht, muss man nicht den Anspruch eines Belegs erfüllen. In der Literatur wird die Willensmetaphysik als eine Deutung der in der Erfahrung gesammelten Beobachtungen verstanden, die wiederum zur Auslegung der Erfahrung genutzt wird. Allerdings wird Schopenhauer ein größerer Wahrheitsanspruch unterstellt als bei einer Deutung zu erwarten ist.
In der Gesamtbetrachtung bietet Schopenhauer also im besten Fall ein System von kohärenten metaphysischen Aussagen, die die Erfahrungswelt erklären. Für dieses System kann er keine deduktiven Argumente vorlegen, wie ihm auch klar ist. Die gemachten Erfahrungen sollen durch metaphysische Deutungen aus der Erfahrung interpretiert werden. Der sogenannte Analogieschluss ist dabei an der Stelle, an der systematisch ein solches Puzzleteil zu erwarten ist.
Der Name dieser Stelle ist in der Literatur „Analogieschluss“. Obwohl in Anlehnung an Hallich der Begriff „Analogiethese“ oder vielleicht besser „Analogiehypothese“ treffender erscheint, ist es natürlich weiterhin sinnvoll, vom „Analogieschluss“ oder eben dem „sogenannten Analogieschluss“ zu sprechen, weil der Bezug etabliert ist. Dennoch wäre es wissenschaftsgeschichtlich interessant, herauszufinden, wie dieser Begriff in diesem Kontext etabliert wurde.
Literatur
Siglen/Zitierweise der Werke Schopenhauers
Normalzitierung der von Schopenhauer selbst veröffentlichten Werke erfolgt, falls nicht anders angegeben, nach: Arthur Schopenhauers sämtliche Werke. Herausgegeben von Paul Deussen, München 2011. Neu herausgegeben InfoSoftWare, Berlin 2001-2008.[290]
Deu I (W I) Die Welt als Wille und Vorstellung, 1. Band
Deu II (W II) Die Welt als Wille und Vorstellung, 2. Band
Deu III Kleinere Hauptschriften
(Diss) Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (1813) S. 1 ff.
(G) Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (1847) S. 101 ff.
(N) Ueber den Willen in der Natur S. 269 ff.
(E I) Preisschrift über die Freiheit des Willens. S. 471 ff.
(E II) Preisschrift über die Grundlage der Moral. S. 573 ff.
Deu IV (P I) Parerga und Paralipomena, 1. Band
Deu V (P II) Parerga und Paralipomena, 2. Band
Deu VI Philosophische Nebenschriften
Deu IX Vorlesungen
Deu X Vorlesungen
Arthur Schopenhauer. Der handschriftliche Nachlaß. Herausgegeben von Arthur Hübscher. 5 Bände, in Frankfurt am Main: Verlag W. Kramer, 1966-1975.
HN I Die frühen Manuskripte 1804 – 1818
HN II Kritische Auseinandersetzungen 1809 – 1818
HN III Berliner Manuskripte 1818 – 1830
HN IV (1) Die Manuskripte der Jahre 1830 - 1852
HN IV (2) Letzte Manuskripte/Graciáns Handorakel
HN V Arthur Schopenhauers Randschriften zu Büchern
Literaturverzeichnis
- Baumgarten, Hans-Ulrich: „Ding an sich“. In: Willaschek, Marcus/Stolzenberg, Jürgen/Mohr, Georg/Bacin, Stefano: Kant-Lexikon. Band 1: a priori/a posteriori – Gymnastik. Boston/Berlin 2015, 426-429.
- Baronett, Stan: Logic. New Jersey 2008.
- Beisel, Marie-Christine: Schopenhauer und die Spiegelneurone. Eine Untersuchung der Schopenhauer’schen Mitleidsethik im Lichte der neurowissenschaftlichen Spiegelneuronentheorie. Würzburg 2012.
- Birnbacher, Dieter: „Induktion oder Expression? Zu Schopenhauers Metaphilosophie“. In: Schopenhauer-Jahrbuch (101), 1988, 7–19.
- Birnbacher, Dieter: Schopenhauer. Stuttgart 2009.
- Blackburn, Simon: Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford 32016.
- Booms, Martin: Aporie und Subjekt. Die erkenntnistheoretische Entfaltungslogik der Philosophie Schopenhauers. Würzburg 2003.
- Ciracì, Fabio: „Analogie/Analogon“. In: Schubbe, Daniel/Lemanski, Jens (Hg.): Schopenhauer-Lexikon. Paderborn 2021, 49 f.
- Dalferth, Ingolf/Hunziker, Andreas: „Einleitung: Aspekte des Problemkomplexes Mitleid“. In: Dalferth, Ingolf/Hunziker, Andreas (Hg.): Mitleid. Tübingen 2007, IX–XXV.
- Decher, Friedhelm: „Metaphysik“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 60–68.
- Dobrzański, Michał: Begriff und Methode bei Arthur Schopenhauer. Würzburg 2017.
- Frauenstädt, Julius: „Schopenhauers Weg ins Innere der Natur“. In: Spierling, Volker: Materialien zu Schopenhauers ‚Die Welt als Wille und Vorstellung‘. Frankfurt 1984, 235–252.
- Gebrecht, Raphael: „Das Verhältnis von Subjektivität und Zeit bei Kant und Schopenhauer“. In: Kant-Studien (112), 2021, 551–593.
- Goethe, Johann Wolfgang von: Berliner Ausgabe: Poetische Werke: Bd. 11 Wilhelm Meisters Wanderjahre. Berlin/Weimar, 21972.
- Goller, Hans: Erleben, Erinnern, Handeln. Eine Einführung in die Psychologie und ihre philosophischen Grenzfragen. Stuttgart 2009.
- Gwinner, Wilhelm: Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgange dargestellt. Ein Blick auf sein Leben, seinen Charakter und seine Lehre. Leipzig 1862.
- Hallich, Oliver: Mitleid und Moral. Schopenhauers Leidensethik und die moderne Moralphilosophie. Würzburg 1998.
- Hallich, Oliver: „Von der Transzendentalphilosophie zur Metaphysik“. In: Hallich, Oliver/Koßler, Matthias (Hg.): Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Berlin 2014, 51–70.
- Hallich, Oliver: „Ethik“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 80–92.
- Hallich, Oliver: „Mitleid“. In: Schubbe, Daniel/Lemanski, Jens (Hg.): Schopenhauer-Lexikon. Paderborn 2021, 183 f.
- Hasse, Heinrich: Schopenhauer. München 1926.
- Heller, Theodor: Logik und Axiologie der analogen Rechtsanwendung. Berlin/Boston 1961.
- Hübscher, Arthur: „Lessing — Schelling — Frauenstädt. Unbekannte Randschriften Schopenhauers“. In: Schopenhauer-Jahrbuch (63), 1982, 1–21.
- Hübscher, Arthur (Hg.): Gesammelte Briefe. Bonn ²1987.
- Jeske, Michael: „Kritische Theorie“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 368–374.
- Jeske, Michael: „Ludwig Feuerbach“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 264–270.
- Juhos, B. v.: „Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik zur Philosophie Schopenhauers?“. In: Emge, C. A./Schweinichen, Otto v. (Hg.): Gedächtnisschrift für Arthur Schopenhauer zur 150. Wiederkehr seines Geburtstages. Berlin 1938, 119–139.
- Kormann, Friedrich: „Über zwei seltsame Widersprüche“. In: Schopenhauer-Jahrbuch (1), 1912, 40–44.
- Koßler, Matthias: Substantielles Wissen und subjektives Handeln. Dargestellt in einem Vergleich von Hegel und Schopenhauer. Frankfurt 1990.
- Koßler, Matthias: Empirische Ethik und christliche Moral. Zur Differenz einer areligiösen und einer religiösen Grundlegung der Ethik am Beispiel der Gegenüberstellung Schopenhauers mit Augustinus, der Scholastik und Luther. Würzburg 1999.
- Leighton, Stephen: „On Pity and Its Appropriateness“. In: Dalferth, Ingolf/Hunziker, Andreas (Hg.): Mitleid. Tübingen 2007, 99–118.
- Malter, Rudolf: Arthur Schopenhauer. Transzendentalphilosophie und Metaphysik des Willens. Stuttgart 1991.
- Malter, Rudolf: Der eine Gedanke. Hinführung zur Philosophie Arthur Schopenhauers. Darmstadt 22010.
- Malcolm, Norman: Knowledge and Certainty: Essays and Lectures. New Jersey 1963.
- Mechtenberg, Lydia: „Raum und Zeit“. In: Willaschek, Marcus/Stolzenberg, Jürgen/Mohr, Georg/Bacin, Stefano: Kant-Lexikon. Band 2: Habitus – Rührung. Boston/Berlin 2015, 1887.
- Morgenstern, Martin: „Ueber den Willen in der Natur“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 98–105.
- Novembre, Alessandro: „Johann Gottlieb Fichte“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 231–237.
- Russell, Bertrand: Human Knowledge: Its Scope and Limits. New York 1948.
- Schmidt, Alfred: „Wesen, Ort und Funktion der Kunst in der Philosophie Schopenhauers“. In: Baum, Günther/Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer und die Künste. Göttingen 2005, 11–55.
- Scholz, Oliver R.: „Verstehen – Objekte, Aufgaben und Hindernisse“. In: Mauz, Andreas/Tietz, Christiane (Hg.): Verstehen und Interpretieren. Paderborn 2020, 21–38.
- Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung: vier Bücher nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthält. Digitalisiert von der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg. Leipzig 1819.
- Schopenhauer, Arthur: Der handschriftliche Nachlaß. Herausgegeben von Arthur Hübscher. 5 Bände, Frankfurt am Main: Verlag W. Kramer, 1966–1975.
- Schopenhauer, Arthur: Sämtliche Werke, herausgegeben von Paul Deussen, München 2011. Neu herausgegeben InfoSoftWare. Berlin 2001–2008.
- Schubbe, Daniel: Philosophie des Zwischen. Hermeneutik und Aporetik bei Schopenhauer. Würzburg 2010.
- Schubbe, Daniel: „Hermeneutik“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 357–361.
- Spierling, Volker: Arthur Schopenhauer zur Einführung. Hamburg 2002.
- Strebel, Christoph: „‚Mitleid‘ aus gestalttheoretischer Perspektive“. In: Dalferth, Ingolf/Hunziker, Andreas (Hg.): Mitleid. Tübingen 2007, 259–288.
- Strohm, Harald: Die Aporien in Schopenhauers Erkenntnistheorie. Tübingen 1984.
- Suhm, Christian: „Analogie“. In: Willaschek, Marcus/Stolzenberg, Jürgen/Mohr, Georg/Bacin, Stefano: Kant-Lexikon. Band 1: a priori/a posteriori – Gymnastik. Boston/Berlin 2015, 57–59.
- Takeuchi, Tsunafumi: „Nietzsche’s Critique of Schopenhauer’s Morality of Compassion“. In: Schopenhauer-Jahrbuch (101), 2020, 227–240.
- Voigtländer, Hanns-Dieter: „Das Problem der Lehrbarkeit der Tugend bei Platon und bei Schopenhauer“ In: Schopenhauer-Jahrbuch (101), 1988, 333–348.
- Welsen, Peter: Schopenhauers Theorie des Subjekts. Würzburg 1995.
- Weimer, Wolfgang: „Analytische Philosophie“. In: Schubbe, Daniel/Koßler, Matthias (Hg.): Schopenhauer Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 22018, 345–349.
- Westerhoff, Armin: „Zwischen Ganzheits- und Differenzdenken. Goethes Analogie-Verständnis mit Blick auf ‚Wilhelm Meisters Wanderjahre‘“. In: Schrader, Hans-Jürgen/Weder, Katharine: Goethes analogisch-philosophische Konzepte. Tübingen 2004, 129–145.
- Worré, Pascale: Arthur Schopenhauers „einziger Gedanke“ und das Oupnekʼhat. Trier 2019.
- Zeller, Eduard: Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz. Digitalisiert durch die Bayerische Staatsbibliothek. München 1873.
- Zimmermann, Ekkehard: Der Analogieschluß in der Lehre von der Ich-Welt-Identität bei Arthur Schopenhauer. München 1970.
[1] Matthias Koßler: Empirische Ethik, 186.
[2] Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 18.
[3] Vgl. Deu-I:14 (W I, § 4).
[4] Vgl. Deu-I:17 (W I, § 5).
[5] Vgl. Deu-I:19 (W I, § 5).
[6] Schopenhauers will auf Kants Philosophie aufbauen: „Meine Philosophie knüpft unmittelbar an Kants Lehre an […]“. Vgl. HNIV:271.
[7] Arthur Hübscher: Gesammelte Briefe, 246 f.
[8] Vgl. Deu-I:129 (W I, § 20).
[9] Vgl. Deu-I:364 (W I, § 56).
[10] Deu-I:367 f. (W I, § 57).
[11] Vgl. Deu-I:237 (W I, § 39).
[12] Vgl. Deu-I:479 (W I, § 70).
[13] Vgl. Fabio Ciracì: Analogie, 49.
[14] Vgl. Stan Baronett: Logic, 30 f.
[15] Vgl. ebd.; und Christian Suhm: Analogie, 58.
[16] Goethe zu zitieren ist in dem Fall nicht bloß illustrativ oder plakativ, sondern er stand in der Entstehungszeit von Schopenhauers Philosophie mit ihm in Kontakt und zudem hat Goethe sich intensiv mit Analogien beschäftigt.
[17] Vgl. Armin Westerhoff: Zwischen Ganzheits- und Differenzdenken, 137 ff.
[18] Vgl. Simon Blackburn: Oxford Dictionary, 17
[19] Vgl. Theodor Heller: Logik und Axiologie, 44.
[20] Vgl. Armin Westerhoff: Zwischen Ganzheits- und Differenzdenken, 131.
[21] Ebd., 132.
[22] Vgl. Christian Suhm: Analogie, 58.
[23] Vgl. Stan Baronett: Logic, 327 f.
[24] Baronett nennt drei „Strategies of Evaluation“, allerdings sind die „unintended consequences of analogies“ nicht Bewertungsmaßstab für Analogien, sondern rhetorische Strategeme für Streitgespräche und erinnern an „Konsequenzmacherei“ aus dem Kunstgriff 24 der Eristischen Dialektik von Schopenhauer, vgl. Deu-VI:417. Außerdem ist eine Gegenanalogie der Struktur nach eben diese dritte Variante, allerdings ohne ein weiteres Objekt.
[25] Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, 316.
[26] Vgl. Stan Baronett: Logic, 332.
[27] Vgl. Fabio Ciracì: Analogie, 49 f.
[28] Vgl. Deu-II:736 f. (W II, Kap. 50).
[29] Vgl. Ekkehard Zimmermann: Der Analogieschluß, 71.
[30] Deu-I:5 (W I, § 1).
[31] Vgl. Deu-I:10 (W I, § 4).
[32] Vgl. Deu-I:22 (W I, § 6).
[33] Vgl. Deu-I:118 ff. (W I, § 18).
[34] Deu-I:119 (W I, § 18).
[35] Deu-I:120 (W I, § 18).
[36] Vgl. Deu-I:120 (W I, § 18).
[37] Vgl. Deu-I:121 (W I, § 18).
[38] Deu-III:319 (N, Physiologie und Pathologie).
[39] Deu-I:130 f. (W I, § 21).
[40] Vgl. Deu-I:121 (W I, § 18).
[41] Vgl. Hans Goller: Erleben, Erinnern, Handeln, 19.
[42] Deu-I:122 (W I, § 18).
[43] Vgl. Deu-I:122 (W I, § 18).
[44] Deu-I:121 (W I, § 18).
[45] Vgl. Deu-II:218 (W II, Kap. 18).
[46] Deu-II:218 (W II, Kap. 18).
[47] Der Wille als mögliches Ding an sich eines Individuums wird zwar implizit in § 6 W I (Deu-I:22) und § 7 W I (Deu-I:30) erwähnt, aber explizit erst in § 21 W I (Deu-I:131).
[48] Vgl. Deu-I:122 (W I, § 18).
[49] Deu-I:123 (W I, § 19).
[50] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 18.
[51] Deu-I:125 (W I, § 19).
[52] Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 18.
[53] Deu-I:125 (W I, § 19).
[54] Deu-I:125 (W I, § 19).
[55] Simon Blackburn: Oxford Dictionary, 169.
[56] Deu-I:123 (W I, § 19).
[57] Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 19.
[58] Vgl. Fabio Ciracì: Analogie, 49 f.
[59] Deu-I:126 (W I, § 19).
[60] Deu-I:131 (W I, § 21).
[61] Vgl. Hans-Ulrich Baumgarten: Ding an sich, 426 f.
[62] Deu-I:121 (W I, § 18).
[63] Deu-I:133 (W I, § 22).
[64] Vgl. Deu-III:137 (G, § 18).
[65] Vgl. Deu-I:131 (W I, § 21).
[66] Vgl. Lydia Mechtenberg: Raum und Zeit, 1887.
[67] Deu-I:134 (W I, § 23).
[68] Deu-I:134 (W I, § 23).
[69] Deu-I:133 (W I, § 22).
[70] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 22f.
[71] Vgl. Deu-I:123 (W I, § 19).
[72] Deu-I:124 (W I, § 19).
[73] Martin Booms: Aporie und Subjekt, 298.
[74] Ebd., 297.
[75] Vgl. ebd.
[76] Vgl. Fabio Ciracì: Analogie, 49.
[77] Vgl. Deu-III:55 (Diss, § 31).
[78] Deu-I:124 (W I, § 19).
[79] Vgl. Deu-I:125 (W I, § 19).
[80] Vgl. Friedhelm Decher: Metaphysik, 62 f.
[81] Vgl. ebd., 64.
[82] Vgl. Oliver Hallich: Ethik, 83.
[83] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 18.
[84] Vgl. ebd., 17.
[85] Vgl. ebd., 21 ff.
[86] Raphael Gebrecht: Das Verhältnis von Subjektivität und Zeit, 583.
[87] Vgl. Wilhelm Gwinner: Arthur Schopenhauer,164.
[88] Vgl. Heinrich Hasse: Schopenhauer, 213 f.
[89] Oliver Hallich: Von der Transzendentalphilosophie, 60.
[90] Arthur Hübscher: Gesammelte Briefe, 246 f.
[91] Vgl. Oliver Hallich: Von der Transzendentalphilosophie, 62.
[92] Vgl. Deu-I:17 (W I, § 5).
[93] Deu-I:17 (W I, § 5).
[94] Vgl. Oliver Hallich: Von der Transzendentalphilosophie, 61.
[95] Vgl. ebd., 64.
[96] Ebd., 66.
[97] Vgl. ebd., 65.
[98] Ebd., 64.
[99] Vgl. ebd., 65.
[100] Vgl. Michael Jeske: Ludwig Feuerbach, 265; und Michael Jeske: Kritische Theorie, 370.
[101] Vgl. B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 129.
[102] Vgl. Matthias Koßler: Substantielles Wissen, 115.
[103] Matthias Koßler: Empirische Ethik, 187.
[104] Deu-I:124 (W I, § 19).
[105] Vgl. Deu-I:119 (W I, § 18).
[106] Vgl. Rudolf Malter: Arthur Schopenhauer, 225.
[107] Vgl. ebd., 228 ff.
[108] Vgl. Alessandro Novembre: Johann Gottlieb Fichte, 236.
[109] Vgl. Daniel Schubbe: Hermeneutik, 358.
[110] Daniel Schubbe: Philosophie des Zwischen, 115.
[111] Vgl. Volker Spierling: Arthur Schopenhauer, 66.
[112] Harald Strohm: Die Aporien in Schopenhauers Erkenntnistheorie, 26.
[113] Ebd., 28.
[114] Peter Welsen: Schopenhauers Theorie des Subjekts, 277.
[115] Vgl. ebd., 277 f.
[116] Vgl. Wolfgang Weimer: Analytische Philosophie, 347.
[117] Vgl. Ekkehard Zimmermann: Der Analogieschluß, 63.
[118] Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, 316.
[119] Vgl. Deu-IX:9 (Probevorlesung 1820).
[120] Vgl. Deu-IX:8 (Probevorlesung 1820).
[121] Vgl. Deu-IX:10 (Probevorlesung 1820).
[122] Vgl. Deu-IX:9 (Probevorlesung 1820).
[123] Vgl. Deu-IX:11 (Probevorlesung 1820).
[124] Deu-IX:10 f. (Probevorlesung 1820).
[125] Deu-IX:12 f. (Probevorlesung 1820).
[126] Vgl. Deu-IX:11 f. (Probevorlesung 1820).
[127] Vgl. Deu-IX:21 (Probevorlesung 1820).
[128] Vgl. Deu-IX:20 (Probevorlesung 1820).
[129] Vgl. Deu-IX:19 (Probevorlesung 1820).
[130] Vgl. Deu-IX:13 (Probevorlesung 1820).
[131] Vgl. Deu-IX:22 f. (Probevorlesung 1820).
[132] Deu-IX:23 (Probevorlesung 1820).
[133] Vgl. Deu-IX:16 (Probevorlesung 1820).
[134] Julius Frauenstädt: Schopenhauers Weg ins Innere der Natur, 242.
[135] Bertrand Russell: Human Knowledge, 89.
[136] Bertrand Russell: Human Knowledge, 90.
[137] Deu-I:119 (W I, § 18).
[138] Vgl. Norman Malcolm: Knowledge and Certainty, 131.
[139] Vgl. Wolfgang Weimer: Analytische Philosophie, 347.
[140] Mit „Objektklasse“ benennt Schopenhauer in der Regel Klassen von Vorstellungen in seiner Dissertation (Kausalität, Begriffe, Arithmetik/Geometrie, Motivation).
[141] Deu-I:118 (W I, § 18).
[142] Deu-I:120 (W I, § 18).
[143] Deu-V:318 (P II, § 149).
[144] Vgl. Pascale Worré: Arthur Schopenhauers „einziger Gedanke“, 117.
[145] Deu-I:193 (W I, § 29).
[146] Deu-IX:116 (Vorlesung über die gesammte Philosophie (1820), Erster Theil, Cap. 1).
[147] Vgl. Pascale Worré: Arthur Schopenhauers „einziger Gedanke“, 19.
[148] Vgl. Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung [erste Auflage], 154 f.
[149] Vgl. Deu-I:125 (W I, § 19).
[150] Deu-X:40 f. (Vorlesung über die gesammte Philosophie (1820), Zweiter Theil, Cap. 4).
[151] Deu-X:55 f. (Vorlesung über die gesammte Philosophie (1820), Zweiter Theil, Cap. 6).
[152] Vgl. Marie-Christine Beisel: Schopenhauer und die Spiegelneurone, 56 f.
[153] Ebd., 56.
[154] Deu-I:134 (W I, § 23).
[155] Vgl. Marie-Christine Beisel Schopenhauer und die Spiegelneurone, 53.
[156] Vgl. Tsunafumi Takeuchi: Nietzsche’s Critique of Schopenhauer’s Morality of Compassion, 228.
[157] Vgl. Marie-Christine Beisel Schopenhauer und die Spiegelneurone, 150.
[158] Deu-V:189 (P II, § 100).
[159] Deu-V:318 (P II, § 149).
[160] Deu-III:706 (E II, § 19).
[161] Vgl. Marie-Christine Beisel Schopenhauer und die Spiegelneurone, 148.
[162] Vgl. Deu-III:679 (E II I, § 16).
[163] Vgl. Marie-Christine Beisel Schopenhauer und die Spiegelneurone, 57.
[164] Vgl. ebd., 18.
[165] Vgl. ebd., 57.
[166] Vgl. HN I:391.
[167] Deu-I:437 f. (W I, § 66).
[168] Deu-I:439 (W I, § 66).
[169] Deu-I:439 f. (W I, § 66).
[170] Deu-I:440 (W I, § 66).
[171] Deu-I:440 (W I, § 66).
[172] Dies gilt nach Schopenhauer auch für die anorganische Natur. Allerdings spricht er davon, dass sowohl die Pflanzenwelt als auch die unbelebte Natur ein Analogon zu Schmerz haben müssen. Dieses kann aber vernachlässigt werden, da sie kein Bewusstsein haben. Vgl. HNIII:531.
[173] Deu-I:365 (W I, § 56).
[174] Deu-I:441 (W I, § 66).
[175] Deu-III:679 (E II I, § 16).
[176] Deu-III:679 (E II, § 16).
[177] Deu-III:684 (E II, § 17).
[178] Deu-II:228 (W II, Kap. 19).
[179] Vgl. Deu-I:366 (W I, § 56).
[180] Vgl. Deu-I:123 (W I, § 19).
[181] Deu-III:743 (E II, § 22).
[182] Deu-V:318 (P II, Kapitel XII, § 150).
[183] Vgl. Ingolf Dalferth/Andreas Hunziker: Einleitung: Aspekte des Problemkomplexes Mitleid, IX f.
[184] Vgl. Stephen Leighton: On Pity, 99.
[185] Vgl. Christoph Strebel: ‚Mitleid‘, 281.
[186] B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 136.
[187] Vgl. Oliver Hallich: Mitleid, 183.
[188] Vgl. Oliver Hallich: Mitleid und Moral, 44 ff.
[189] Deu-I:452 (W I, § 68).
[190] Vgl. Hanns-Dieter Voigtländer: Das Problem der Lehrbarkeit der Tugend, 341.
[191] Deu-I:447 (W I, § 68).
[192] Deu-X:547 (Vorlesung über die gesammte Philosophie (1820) IV, Cap. 9).
[193] HNI:342.
[194] Hübscher bezeichnet Ideen als Mittelstufen zwischen Wille Objekten in der Vorstellung. Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 163.
[195] Deu-I:205 f. (W I, § 32).
[196] Arthur Hübscher: Gesammelte Briefe, 246 f.
[197] Deu-I:219 f. (W I, § 36).
[198] Vgl. Alfred Schmidt: Wesen, Ort und Funktion der Kunst, 19.
[199] Vgl. Dieter Birnbacher: Schopenhauer, 115.
[200] Fabio Ciracì: Analogie, 49.
[201] Deu-I:178 (W I, § 27).
[202] Vgl. Friedhelm Decher, Metaphysik, 66.
[203] Deu-I:182 (W I, § 28).
[204] Deu-I:172 (W I, § 27).
[205] HNIII:531.
[206] Deu-III:271 (N, Vorrede).
[207] Deu-X:51 (Vorlesung über die gesammte Philosophie. Zweiter Theil, Cap. 5).
[208] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 98.
[209] Deu-III:293 (N, Einleitung).
[210] Vgl. Deu-II:218 (W II, Kap. 18).
[211] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 98 f.
[212] Vgl. ebd., 98.
[213] Deu-III:296 (N, Einleitung).
[214] Deu-III:297 (N, Einleitung).
[215] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 99.
[216] Deu-III:297 (N, Physiologie und Pathologie).
[217] Vgl. Deu-III:306 (N, Physiologie und Pathologie). Rosas wurde von Schopenhauer mehrfach des Plagiats beschuldigt. Vgl. Arthur Hübscher: Lessing — Schelling — Frauenstädt, 20.
[218] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 104.
[219] Vgl. Deu-III:302 ff. (N, Physiologie und Pathologie).
[220] Vgl. Deu-III:306 (N, Physiologie und Pathologie).
[221] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 100.
[222] Deu-III:325 (N, Vergleichende Anatomie).
[223] Deu-III:330 (N, Vergleichende Anatomie).
[224] Vgl. Deu-I:60 (W I, § 10).
[225] Deu-I:172 (W I, § 27).
[226] Deu-III:311 (N, Physiologie und Pathologie).
[227] Deu-III:312 f. (N, Physiologie und Pathologie).
[228] Deu-III:347 (N, Pflanzen-Physiologie).
[229] Vgl. Deu-III:350 f. (N, Pflanzen-Physiologie).
[230] Vgl. Deu-III:350 f. (N, Pflanzen-Physiologie).
[231] Deu-III:368 f. (N, Physische Astronomie).
[232] Schopenhauer präsentiert Beispiele aus Englisch, Deutsch, Latein, Griechisch, Italienisch, Französisch und Sanskrit.
[233] Deu-III:380 (N, Linguistik).
[234] Vgl. Deu-III:381 (N, Linguistik).
[235] Vgl. Deu-III:381 f. (N, Linguistik).
[236] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 102.
[237] Deu-III:387 (N, Animalischer Magnetismus und Magie).
[238] Vgl. Deu-III:386 f. (N, Animalischer Magnetismus und Magie).
[239] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 103.
[240] Vgl. Deu-III:55 (Diss, § 31).
[241] Vgl. Deu-III:29 (Diss, § 23).
[242] Deu-I:134 (W I, § 23).
[243] Vgl. Deu-I:124 (W I, § 19).
[244] Deu-II:218 (W II, Kap. 18).
[245] Vgl. B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 129.
[246] Ebd., 127.
[247] B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 128.
[248] Arthur Hübscher: Gesammelte Briefe, 246 f.
[249] Deu-IV:151 (P I, § 14).
[250] Vgl. B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 129.
[251] Ebd.
[252] B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 130.
[253] Interessant ist, dass Juhos davon ausgeht, Schopenhauer im Glauben sei, streng wissenschaftlich zu verfahren. Vgl. B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 135. Überwiegend spricht Schopenhauer davon, dass das Ding an sich nicht nachgewiesen kann. Insbesondere kann er so nicht davon ausgehen, dass er dies deduktiv nachgewiesen hat.
[254] Vgl. B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 137.
[255] Vgl. ebd., 135.
[256] Vgl. ebd., 130.
[257] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 120.
[258] Deu-I:60 (W I, § 10).
[259] Deu-I:59 (W I, § 10)
[260] Deu-I:78 (W I, § 14).
[261] Vgl. Oliver Hallich: Von der Transzendentalphilosophie, 64.
[262] Ebd.
[263] Vgl. Dieter Birnbacher: Induktion oder Expression, 11.
[264] Deu-IV:149 f. (P I, § 14).
[265] Deu-I:XIX f. (W I, Vorrede).
[266] Deu-IV:149 (P I, § 14).
[267] Das erste Schopenhauer-Jahrbuch ist diesem Thema gleich gewidmet (Seite 1) und der Herausgeber kommentiert einen Beitrag eines Mitglieds über Widersprüche. Vgl. Friedrich Kormann: Über zwei seltsame Widersprüche, 42 ff.
[268] Eduard Zeller: Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, 894.
[269] Eine ausführliche Darstellung findet sich bei Daniel Schubbe: Philosophie des Zwischen, 88 ff.
[270] Deu-III:312 (N, Physiologie und Pathologie).
[271] Deu-II:294 (W II, Kap. 20).
[272] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 100.
[273] Deu-III:312 f. (N, Physiologie und Pathologie).
[274] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 17.
[275] Vgl. B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 129.
[276] Vgl. Peter Welsen: Schopenhauers Theorie des Subjekts, 277 f.
[277] B. v. Juhos: Wie stellt sich die neuere Erkenntniskritik, 136.
[278] Vgl. Martin Morgenstern: Ueber den Willen in der Natur, 98 f.
[279] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 199.
[280] In der Schopenhauer-Literatur herrscht, so Dobrzański, größtenteils Einigkeit darin, dass man in Bezug auf Schopenhauers Philosophie von einer Hermeneutik sprechen kann. Für eine Hermeneutik spreche die Methode der Daseinsdeutung mit nichtlinearer Subjektbezogenheit. Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 203. Dieser Begriff wird hier nicht genutzt, weil er traditionell als Auslegung von Produkten menschlicher Handlungen verstanden wird und damit auch eine bewusste Komponente enthält. Vgl. Oliver R. Scholz: Verstehen, 26 f.
[281] Vgl. Michał Dobrzański: Begriff und Methode, 201.
[282] Deu-II:733 f. (W II, Kapitel 50).
[283] Deu-II:202 f. (W II, Kapitel 17).
[284] Dieter Birnbacher: Induktion oder Expression, 11.
[285] Vgl. ebd., 13.
[286] Vgl. ebd., 14.
[287] Deu-II:733 f. (W II, Kap. 50).
[288] Vgl. Dieter Birnbacher: Induktion oder Expression, 14 f.
[289] Rudolf Malter: Der eine Gedanke, 130 f.
[290] Seitenkonkordanzen für die Werkausgaben finden sich in: Daniel Schubbe/Matthias Koßler (Hrsg.), Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2018, 441 ff.